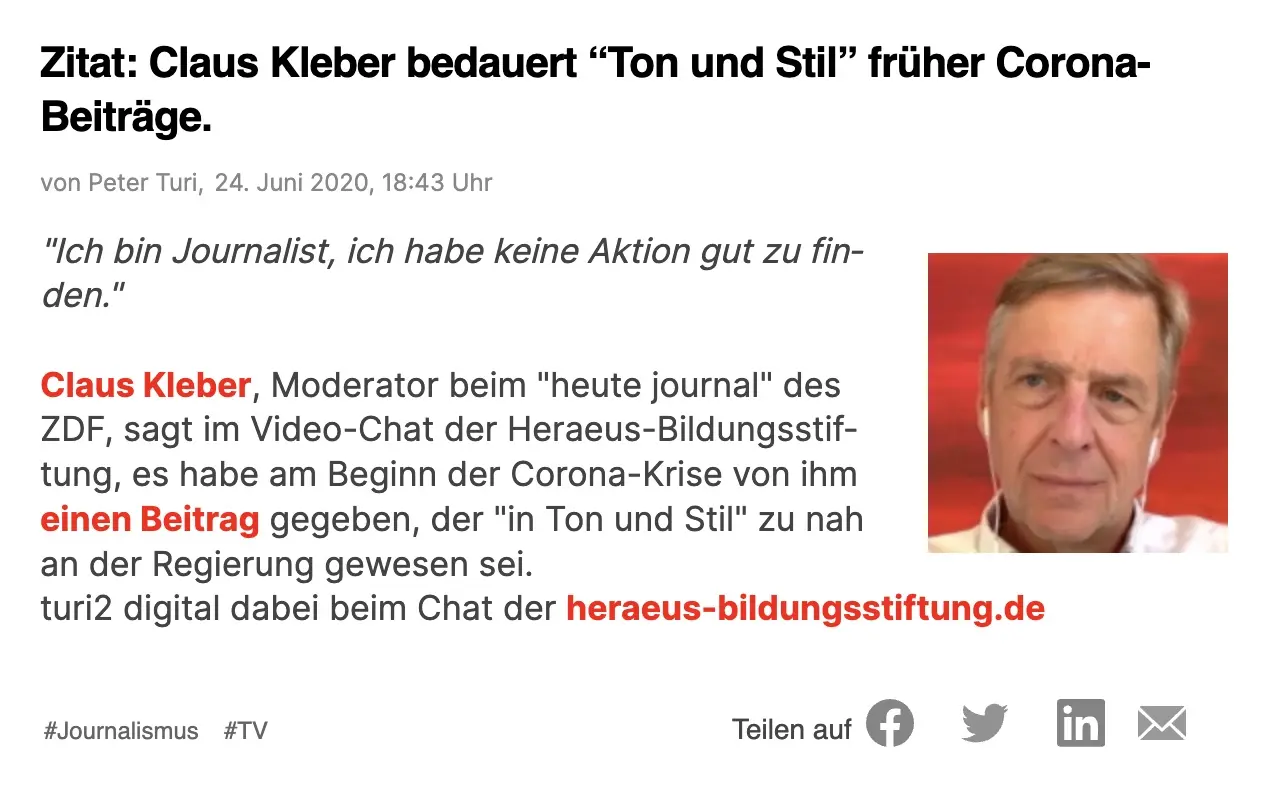Es ist erstaunlich, wie oft der Begriff Meinungsfreiheit bemüht wird, wenn eigentlich etwas ganz anderes gemeint ist. Die gestrige Ausgabe der Talkshow „Markus Lanz“ bot ein erhellendes Schauspiel: auf der Bühne die Neurowissenschaftlerin Maren Urner, der Herausgeber der Welt Ulf Poschardt, der notorisch widerborstige Boris Palmer und natürlich der Gastgeber selbst – mal Stichwortgeber, mal süffisanter Stichler.
Maren Urner sprach mit ruhiger Stimme, aber mit der Klarheit einer, die weiß, wovon sie spricht. Für sie ist der Streit um die Meinungsfreiheit vor allem ein Symptom. Kein Ausdruck tatsächlicher Repression, sondern das Resultat einer Wahrnehmung, die sich durch Wiederholung, mediale Verstärkung und digitale Echokammern zur gefühlten Wahrheit aufschwingt. Der zentrale Satz ihrer Argumentation lautete sinngemäß: „Wenn Menschen sagen, sie hätten das Gefühl, ihre Meinung nicht mehr sagen zu dürfen, dann ist es genau das – ein Gefühl. Und Gefühle entstehen nicht im luftleeren Raum, sondern durch unser Umfeld, durch das, was wir sehen, lesen, hören – und glauben.“
Diese Unterscheidung zwischen Gefühl und Realität war für Urner kein semantischer Taschenspielertrick, sondern der Schlüssel zur ganzen Debatte. Sie blieb sachlich, erklärte neuronale Muster, erinnerte daran, wie leicht sich Meinungen durch Wiederholung einschleifen – und wie gefährlich das ist, wenn populistische Kräfte daraus politisches Kapital schlagen.
Doch mit dieser Analyse stieß sie auf Widerstand. Ulf Poschardt, der sich selbst als Verteidiger der liberalen Demokratie sieht, zeigte sich schwer beeindruckt – nicht von Urners Argumenten, sondern von den Zahlen einer Umfrage, die nahelegen, dass viele Deutsche sich nicht mehr trauen, frei zu sprechen. Für ihn sind diese Zahlen nicht bloß Gefühl, sondern Alarmzeichen. Dabei ließ er nicht aus, auf ein Meme zu verweisen, das Robert Habeck als „Schwachkopf“ titulierte – und auf den vermeintlich überzogenen Umgang der Behörden damit. Dass das BKA tätig wurde, bevor überhaupt ein Strafantrag gestellt war, interessierte ihn weniger als der Umstand, dass man sich heute für ein Meme vor Gericht verantworten müsse.
Palmer wiederum erzählte – wie so oft – von sich selbst. Von seinem Bruch mit den Grünen, vom Sprachdruck, den er erlebt habe, von der Verachtung, die ihm entgegenschlägt, wenn er bestimmte Begriffe benutzt. Er hielt Urners Argumentation für akademisch – und an seiner Lebensrealität vorbei. Die Menschen auf der Straße, sagte er, sprächen ihn an, dankten ihm für seinen Mut. „Lassen Sie sich nicht unterkriegen“ – das sei der Satz, den er am häufigsten höre. Für ihn der Beweis, dass die gefühlte Einschränkung nicht bloß ein Gefühl sei – sondern gelebte Wirklichkeit.
Man könnte an dieser Stelle fragen: Ist Popularität ein Indikator für Wahrheit? Oder sind es nicht gerade auch Wiedererkennungsmechanismen, die populistischen Narrativen zum Erfolg verhelfen?
Markus Lanz war in dieser Runde mehr als nur Moderator. Seine Spitzen trafen meist subtil, manchmal gezielt unterhalb der Gürtellinie. Er erinnerte daran, dass Angela Merkel in 16 Jahren kein einziges Mal Anzeige wegen Beleidigung gestellt habe – ganz im Gegensatz zu Strack-Zimmermann, Habeck oder Baerbock. „Vielleicht war sie einfach robuster“, sinnierte Lanz, während Palmer und Poschardt dankbar nickten. Doch die feine Ironie blieb spürbar: Wer sich von einem Meme aus der Bahn werfen lässt, dem ist möglicherweise nicht die Meinungsfreiheit entzogen worden – sondern schlicht die Souveränität.
Am stärksten blieb für mich jedoch Urners Gedanke hängen, dass der ständige Alarmruf über den Verlust von Meinungsfreiheit nicht nur irreführend, sondern auch gefährlich sei. Denn er verschiebt den Fokus. Weg von den tatsächlichen Herausforderungen – etwa einem digitalen Raum, in dem Algorithmen Wut belohnen und Differenzierung bestrafen. Und hin zu einem Debattensetting, in dem sich Menschen nicht mehr über Ideen streiten, sondern über Empfindlichkeiten.
Nein, es geht nicht darum, Meinungen zu verbieten. Es geht darum, Verantwortung für Sprache zu übernehmen – besonders, wenn man Millionen erreicht, wie Poschardt. Die Nachfrage Urners, was er mit Begriffen wie Ideologie bezwecke, beantwortete er mit einem Verweis auf Wittgenstein und einem Achselzucken. Das war vielleicht intellektuell gemeint, klang aber eher nach: „Ich sage, was ich will – und wenn’s knallt, dann war’s wohl die Wahrheit.“
Fazit dieser Runde? Die klügsten Gedanken kamen nicht von denen, die von Meinungsfreiheit reden – sondern von derjenigen, die sie analysierte. Maren Urner zeigte: Wer differenziert argumentiert, wird in aufgeheizten Zeiten nicht immer gehört. Aber gerade deshalb brauchen wir solche Stimmen. Nicht nur in Talkshows, sondern überall dort, wo sich Demokratie bewähren muss: im Diskurs, im Alltag, im Zweifel.
Interessant dazu: Marina Weisband