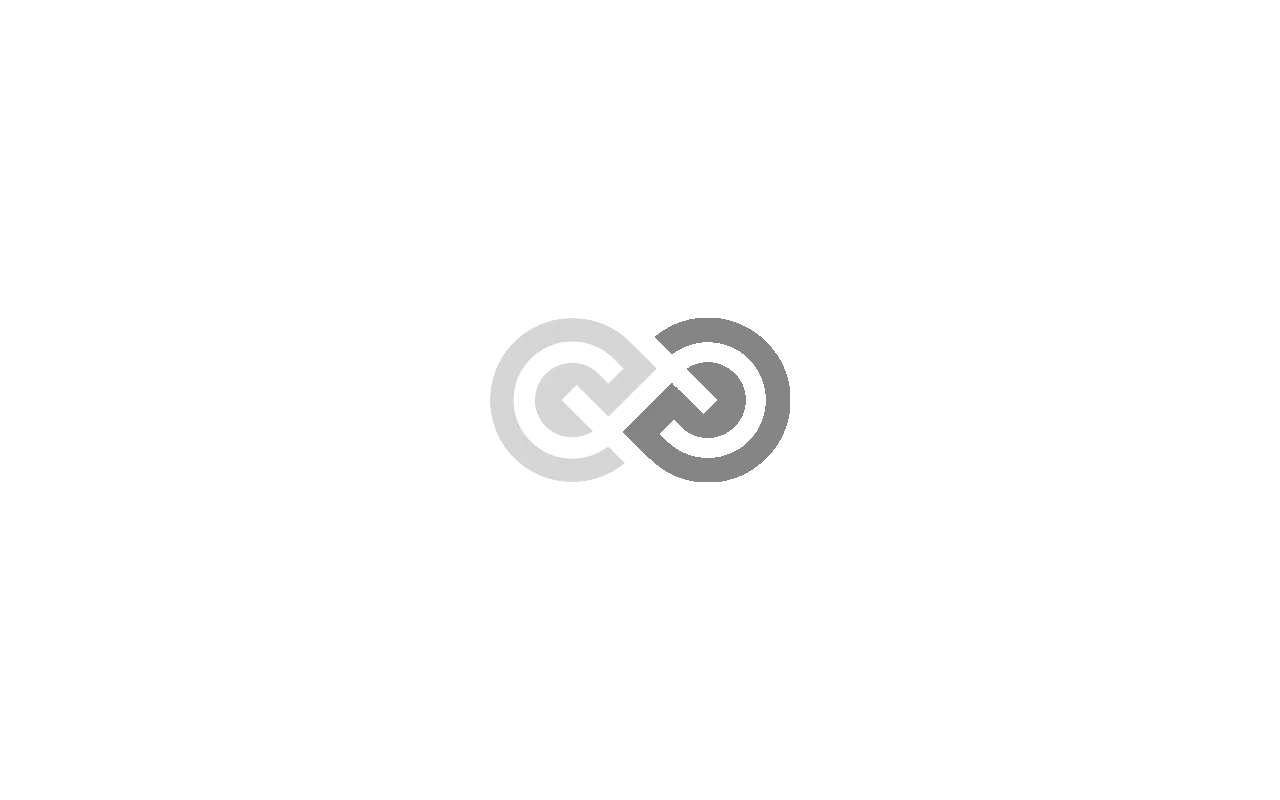Die Rheinischen Linoleumwerke Bedburg – kurz RLB – erzählen eine Geschichte voller Poesie und industrieller Pracht, getragen von der Familie Holtkott und eingebettet in die Blüte wie den Verfall einer Epoche.
Gegründet wurde das Werk 1897 durch Adolf Silverberg und entwickelte sich rasch zu einem der größten Arbeitgeber der Region – bis zu 900 Beschäftigte vor dem Ersten Weltkrieg. 1899 übernahm Richard Holtkott die Leitung, sein Familienname prägt die Firmengeschichte nun fast hundert Jahre lang .
Richard Holtkott, Sammler, Visionär und Unternehmer, formte die Firma. Unter seiner Führung produzierte RLB nicht nur Linoleum, sondern auch Linkrusta‑Tapeten und Wollfilzfußböden. Mit firmeneigener Leinölfabrik, Jute-Spinnerei, Forschungslabor und Zweigstellen in Berlin und Wien wuchs das Unternehmen zur zweitgrößten deutschen Linoleumfabrik nach der DLW AG .
Im 20. Jahrhundert blühte nicht nur die Industrie, sondern auch das soziale Engagement: Richard Holtkott unterstützte nachhaltig den Bau einer öffentlichen Turnhalle, die erste im Kreis Bergheim nach 1945 – eine Geste aus Großzügigkeit und Gemeinschaftssinn .
Doch das Schicksal webt mit unsichtbarer, aber spürbarer Hand: Während in der NS‑Zeit RLB – wie mehrere Betriebe – von Übernahmen ehemals jüdischer Unternehmen profitieren soll, fehlt bislang der eindeutige Nachweis. Das bleibt ein offenes Feld für gründliche archivalische Prüfung .
Ab Ende der 1960er Jahre begann ein langsamer Rückzug. Schon 1973 endete die Linoleumproduktion; der Siegeszug des PVC setzte die RLB zunehmend unter Druck. Der Höhepunkt im Gerichtssaal: 1968–72 wurde RLB in einem Kartellverfahren gegen DLW verwickelt – ein abgehörtes Telefonat zwischen Walter Schächterle (DLW) und dem geschäftsführenden Gesellschafter Walter Holtkott dokumentiert schroff, wie bewusst man gegen Kartellrecht agierte .
1978 folgte der Konkurs; 1979 wurde das Werksgelände abgerissen, heute erinnert das Gewerbegebiet Adolf Silverberg an die vergessenen Maschinenhallen und die Familie, die einst unerschütterlich wirkte .
Mit diesen Facetten liegt die RLB längst nicht mehr im Schatten. Sie lebt in Aktien, Anekdoten, Architekturfragmenten, aber vor allem in den stillen Schritten der Geschichte der Holtkotts – ein Industriegedicht zwischen Fortschritt und Endlichkeit.
Kurzüberblick
Die »Rheinische Linoleumwerke Bedburg AG« (RLB) wurden 1897 von Adolf Silverberg gegründet. 1899 übernahm Richard Holtkott die Führung und prägte das Werk bis zu seinem Tod 1950; später stiegen seine Söhne Alfred (1903–1980) und Walter (1916–1996) ein. RLB blieb lange unabhängig, geriet jedoch in den späten 1960ern/ frühen 1970ern u. a. wegen kartellrechtlicher Verwicklungen in den Blick der Justiz und ging 1978 in Konkurs.
Zeitleiste (ausgewählt)
- 1897: Gründung durch Adolf Silverberg (»Rheinische Linoleumwerke Bedburg AG«) — gut 250 Beschäftigte.
- 1899–1950: Leitung durch Richard Holtkott; Familienunternehmen bleibt unabhängig von Industriekonzernen.
- 1911: US‑Patent von Richard Holtkott zu »lincrusta« (Linoleum‑Veredelung); zeigt technologische Ambition der RLB.
- 1933–45: RLB übernimmt mehrere Betriebe aus jüdischem Besitz (u. a. in Österreich/Prag) — heikler Teil der Firmengeschichte, archivalisch weiter zu prüfen.
- 1968–72: Kartellverfahren (DLW ↔ RLB) – Telefonatshinweis auf Walter Holtkott; SPIEGEL berichtet über interne RLB‑Notiz.
- 1978: Konkurs/Schließung der Fabrik nach über 80 Jahren.
Die Familie Holtkott – dicht porträtiert
- Richard Holtkott (1866–1950): Aus Köln, ab 1899 faktischer Firmenlenker der RLB. Heirat 1900 (Else Graber). Technikaffinität belegt durch Patentaktivität (u. a. 1911 »Process and apparatus for manufacturing lincrusta«). In lokalen Quellen erscheint er auch als Bedburger Mäzen (Spende/Unterstützung Turnhallenbau; Gespräch in Rhöndorf).
- Alfred Holtkott (1903–1980): Eintritt 1924 in die Firma; vertritt die Fortführung der Familienleitung in der Zwischenkriegs‑ und Nachkriegszeit. (In jüngeren lokalen Beiträgen/Kommentaren taucht sein Name familiär erinnert auf.)
- Walter Holtkott (1916–1996): Geschäftsführer/Gesellschafter der späten Phase; namentlich im Kartellkomplex (1968 Telefonat) erwähnt. Seine Rolle markiert die RLB‑Endphase vor dem Konkurs.
Produktion, Technik, Standorte
- RLB produzierte Linoleum, Lincrusta/Relieftapeten und verwandte Beläge; Dokumente nennen Labor‑/Forschungsstellen in Bedburg und Sachakten zu »Linkrusta‑Tapete«. Ein Sammlerstück (Aktie 1920) listet Vertriebsorte (z. B. Köln, Hamburg, Leipzig), was auf ein überregionales Netz schließen lässt. (Auktionshinweise sind Indizien, keine Primärquellen.)
NS‑Zeit (kritischer Knoten)
- Sekundärliteratur vermerkt Übernahmen ehemals jüdischer Unternehmen durch RLB. Für eine belastbare Fallstudie empfehlen sich Einsichtnahmen in Firmenakten/Nachlassbestände (siehe unten). Diese Phase verlangt besonders sorgfältige Quellenarbeit.
Nachkriegszeit bis Konkurs
- RLB blieb »Außenseiter/Unabhängiger« der Branche; zugleich zeigen 1968–72 Akten/Medienberichte kartellrechtswidrige Absprachen mit DLW. Der öffentliche Kartellprozess beschädigte Reputation und Branche; strukturelle Marktveränderungen und Konkurrenzdruck münden in den Konkurs 1978.
Spuren heute
- Das Areal zählt heute zum Gewerbegebiet »Adolf Silverberg«; historische Aktien/Urkunden sind bei Sammlern im Umlauf.
Primärquellen & Archive (für Tiefenrecherche)
- Stiftung Rheinisch‑Westfälisches Wirtschaftsarchiv (RWWA), Köln: Digitalhinweise zu Bestand »Rheinische Linoleumwerke Bedburg« und Nachlass Richard Holtkott (Detailangaben noch nicht online – Vor-Ort‑Recherche ratsam).
- Deutsche Digitale Bibliothek: Sachakten (Labor, »Linkrusta‑Tapete«, Werksanlagen).
- Zeitgenössische Presse: ZEIT (1972) zum Kartellverfahren; SPIEGEL mit Zitaten aus RLB‑Akten.
- Technikquellen: US‑Patent Holtkott (1911). Fachaufsatz (1952) dankt »Werksleitung Richard Holtkott« – Hinweis auf Forschungskooperation.
- Lokale Chroniken/Vereine: TV Bedburg‑Chronik (Spendenbezug); IHK Köln mit populärhistorischer Notiz zum Konkurs 1978.
Offene Fragen (Next Steps)
- Firmenrechtliche Akten (HR‑Einträge, Umfirmierungen, Gesellschafterlisten): Präzise Übergänge 1899/1920er/1960er klären. (RWWA/Amtsregister)
- NS‑Zeit‑Übernahmen: Welche Betriebe, zu welchen Konditionen? Opfer‑/Eigentümerakten sichten (Österreich/Prag‑Archive).
- Kartellverfahren: Urteilstexte/Akten (Kammergericht Berlin) anfordern; Rolle von Walter Holtkott detaillieren.
- Konkurs 1978: Insolvenzakten (Amtsgericht), Presse der Region (Kölner Stadt‑Anzeiger/Neuss‑Grevenbroicher Zeitung) systematisch durchsuchen. (Quellenhinweis aus IHK‑Post)
- Unternehmenssozialgeschichte: Belegschaftszahlen, Betriebsräte, Frauenarbeit, Lehrlingswesen; mögliche Firmenzeitungen. (RWWA/DDB)
Ausschnitt aus einem Beitrag des Kölner Stadt-Anzeiger von 2005
45 Meter Regalboden füllen die Akten über die Firmengeschichte der Rheinischen Linoleumwerke Bedburg im Wirtschaftsarchiv Köln. Dessen Direktor, Dr. Ulrich Soénius, überreichte der Stadt jetzt ein so genanntes Findbuch, in dem zu den Nummern der Akten eine kurze Zusammenfassung des Inhalts verzeichnet ist. »Das ermöglicht Interessierten, gezielt eine Akte in den Lesesaal des Archivs zu bestellen und einzusehen«, erklärt Soénius den Zweck des 460 Seiten starken Werks. In mühevoller Arbeit hat die Historikerin Julia Caun das Findbuch erstellt.
Einträge zu den Familien, die das Unternehmen fast 100 Jahre führten, zur Produktion, zu Grundstücken, dem Ein- und Verkauf und eben auch Strafverfahren finden sich in den Unterlagen, zu denen das Findbuch eine Übersicht bietet.900 BeschäftigteWohl keine andere Firma hatte einen solch großen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt Bedburg wie die Linoleumwerke. »Vor dem Ersten Weltkrieg hatte das Werk 900 Beschäftigte – eine solche Firma könnten wir heute wieder gut gebrauchen«, bemerkte Bürgermeister Gunnar Koerdt mit einem Blick auf die Unternehmensgeschichte. 1897 gründete Adolf Silverberg die Rheinischen Linoleumwerke Bedburg, kurz RLB. Neben der ebenfalls durch die Initiative Silverbergs entstandenen Bedburger Wolle entwickelte sich die Linoleumproduktion schnell zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in der Region, der die Stadt zur Blüte brachte und zahlreiche Neubürger anzog. »In der Zeit von 1861 bis 1910 steigen die Einwohnerzahlen von Bedburg, Lipp, Blerichen und Broich durch die industrielle Entwicklung von unter 1500 auf 3912«, weiß Stadtarchivar Uwe Depcik.
Geprägt wurden die RLB durch die Familie Holtkott. 1899 übernahm Richard Holtkott die Leitung der Firma. Die Söhne Alfred und Walter folgten in den 20er Jahren in die Geschäftsführung. Neben Linoleum produzierten die RLB Linkrusta, ein abwaschbares Tapetenmaterial, sowie einen Fußbodenbelag aus Wollfilz. Vor dem Zweiten Weltkrieg arbeiteten 1000 Menschen in dem Bedburger Werk. Es gab Zweigniederlassungen in Berlin und Wien.Größter HerstellerDurch Kriegsschäden und die starke Einschränkung der Produktion fiel die Zahl der Beschäftigten bis 1945 auf 50 Mitarbeiter. Aber schon in den 50er Jahren gehörte das Bedburger Unternehmen wieder zu den größten Linoleumherstellern Deutschlands.
In den 60ern griffen die Holtkott-Söhne einen neuen Trend auf: Sie ließen hochwertiges PVC produzieren. Dennoch war der Niedergang unaufhaltsam. Anfang der 70er Jahre wurde die Produktion des mittlerweile unpopulären Linoleums eingestellt. Die allgemeine Auftragslage verschlechterte sich. Kurz vor Eröffnung des Konkursverfahren 1978 hatten die RLB noch 250 Mitarbeiter. Das Werksgelände wurde 1979 abgerissen. Zunächst als Stellplatz für eine Autofirma, später von einer Firma für Boden- und Wandbeläge genutzt, kaufte die Stadt das Grundstück 1991 auf. Heute befindet sich das Gewerbegebiet Adolf Silverberg auf dem Gelände.
Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger
IHK – Bericht über die Firmengeschichte
PDF – Datei
Ausschnitt aus einem Artikel von »Die Zeit« aus dem Jahr 1972.
Es geht um ein Verfahren vor dem Bundeskartellamt in Berlin wegen unerlaubter Preisabsprachen, in das auch die RLB Werke verwickelt waren.
In dieser Chronik des Turnvereins Bedburg werden RLB und einige Mitarbeiter des Unternehmens erwähnt.
Auszug aus der Wikipedia:
Eine Außenseiterposition nahmen die Rheinischen Linoleumwerke Bedburg (RLB) ein. Das 1897 gegründete und zeit seines Bestehens im Familienbesitz stehende Unternehmen blieb stets unabhängig von der restlichen Industrie. Im Dritten Reich übernahm die RLB mehrere Unternehmen aus jüdischem Besitz, darunter mit der Österreichische Linoleum-, Wachstuch- und Kunstlederfabriken AG und des Prager Unternehmens Linoleum-Industrie Leopold Blum auch zwei Linoleum-Werke. In der Nachkriegszeit wurde das Unternehmen zum zweitgrößten deutschen Hersteller nach der DLW AG und beschäftigte bis zu 1100 Mitarbeiter.[35]
Jubilarehrung in echter Betriebsgemeinschaft
25jährige Dienstzeit in den rhein. Linoleumwerken
Bedburg. Die rheinischen Linoleumwerke Bedburg hatten für Montag zu einer Feier zu Ehrung der Jubilare des Unternehmens im Saale des Jägerhofes eingeladen. weiter…
Link: wisoveg.de
RICHARD HOLTKOTT (Köln 1866-Rhöndorf 1950), Industrieller, Bedburg. Alte Zeichnungen und Drucke. Richard Holtkott war Geschäftsführer der Rheinischen Linoleumwerke Bedburg (RLB), einer 1897 von Adolf Silverberg gegründeten Linoleumfabrik. 1899 übernahm er die Firma und leitete sie bis zu seinem Tod 1950. 1900 heiratete er Else Graber. Ab 1924 arbeitete auch ihr Sohn Alfred (1903-1980) in der Firma, einige Jahre später ihr Sohn Walter (1916-1996). Nach dem Tod ihres Vaters übernahmen Alfred und Walter bis 1976 die Leitung der Fabrik. Vor dem Ersten Weltkrieg begann Richard Holtkott, alte Drucke und alte Zeichnungen aus dem 19. Jahrhundert zu sammeln. Jahrhundert und später japanische Holzstiche, asiatische Objekte, persische Miniaturen und tibetische Bronzen. Die Zeichnungen und Drucke, die er in großen Mengen sammelte, wurden oft in ganzen Chargen gekauft, was die Qualität der Arbeiten sehr ungleichmäßig machte. Holtkott, der in den 1920er und 1930er Jahren besonders aktiv war, erwarb häufig beim Kölner Kaufmann Walter Bornheim, aber auch bei Auktionen bei Lempertz in Köln oder bei CG Boerner. Die Sammlung alter Drucke bot einen Überblick über die Geschichte der Grafik, da der Sammler eine Kopie jedes Drucks haben wollte, den Bartsch in seiner Arbeit über Maler-Graveure erwähnte. Außerdem hatte er auch einige Lieblingsfächer, wie die Darstellungen von Adam und Eva. Der gleiche Druck war auch in zwei Exemplaren zu finden: eines für die Sammlung nach Bartsch und das andere für die Sammlung von Adam und Eva. Schließlich hatte er vor allem in den 1920er Jahren auch eine Reihe von topografischen Ansichten des Rheins, insbesondere des Siebengebirges, gesammelt, die er besonders mochte, mit einer Villa in Rhöndorf. Er beschränkte sich nicht nur auf Drucke und Zeichnungen mit topografischen Ansichten, sondern erwarb auch Gemälde und Porzellan. Alle topografischen Ansichten von Bonn und Umgebung – über 750 Drucke, 65 Zeichnungen, 30 Alben, 11 Gemälde und 45 Porzellane – wurden Mitte der 1960er Jahre von der Stadt Bonn für die Städtischen Kunstsammlungen erworben und wurden dann kurz im Ernst-Moritz-Arndt-Haus in Bonn vorgestellt. 1991 wurden Werke aus der Zeit vor 1914 zwischen dem neu geschaffenen StadtMuseum Bonn und der Stadtarchiv und Stadthistorischen Bibliothek Bonn aufgeteilt. Nachdem der Sammler und dann seine Frau 1956 verstorben waren, begannen ihre Erben, Teile der Holtkott-Sammlung zu verkaufen, zunächst 1962 bei Karl & Faber in München, dann bei Lempertz in Köln und ab 2002 von den Swann Galleries in New York. Für letztere ist der Verkauf vom 7. November 2002, ab dem 1. st Mai 2003, 6. November 2003 und 29. Januar 2004 , die mehrere Lose aus dem Nachlass Holtkott enthalten. Die unten angegebene Verkaufsliste ist möglicherweise nicht vollständig und wir konnten die verschiedenen Lose nicht immer angeben. Beachten Sie, dass sich unter den Erben noch ein Teil befindet. Es gibt drei Sammlungsmarken: eine mit dem vollständigen Namen (siehe L.4265); diese Marke mit dem Anfangsbuchstaben ‚H‘ und schließlich der Marke ‚Sammlung Richard Holtkott‘ (siehe L.4280). Holtkott soll sich in den 1920er Jahren in allen Buchstaben (L.4265) einen Namen gemacht haben, ihn aber selten auf Zeichnungen und Drucken angebracht haben, die er für Ausstellungen verliehen hat. Die Erben brachten wahrscheinlich nach 1962 zwei Briefmarken an, denn die in diesem Jahr von Karl & Faber verkauften Werke scheinen keine Marke zu tragen: Dies ist beispielsweise der Fall bei einem italienischen Design des 17. Jahrhunderts, das Frits erworben hat Lugt durch W. Jeudwine zum Verkauf am 29. November 1962, München, Karl & Faber, Nr. 327, als Christiaen van Vianen (Paris, Fondation Custodia, Inv. 7775). VERKAUF 1962, 14.-16. Mai, München, Karl & Faber, Auktion 80. Keine Herkunftsangabe, jedoch mehr als 130 Werke der Familie Holtkott. 1962 29. November bis 1. st Dezember München, Karl & Faber, Auktion 82. Keine Angabe der Quelle, sondern nach der Liste Besitzerverzeichnis , ist dies die n os 47 und 119 Zeichnungen und Drucke. 1997, 6. Dezember, Köln, Lempertz. Alte Kunst. Gemälde, Zeichnungen, Skoqueruren ua Gemälde und Zeichnungen aus einer Rheinischen Privatsammlung . Ungefähr 312 antike Zeichnungen des 19. Jahrhunderts (aus der Rheinischen Privatsammlung). 2002, 7. November, New York, Swann, Verkauf 1950. Alter Meister durch zeitgenössische Drucke . Mehrere alte Drucke von Holtkott. 2003, 23. Januar, New York, Swann, Verkauf 1957. Zeichnungen alter Meister . Mehrere Zeichnungen von Holtkott. 2003 1 st Mai, New York, Swann Verkauf 1969 Alter Meister durch Contemporary Prints . Mehrere alte Drucke von Holtkott. 2003, 6. November, New York, Swann, Verkauf 1983. Alter Meister durch zeitgenössische Drucke . Mehrere alte Drucke von Holtkott. 2004, 29. Januar, New York, Swann, Verkauf 1994. Old Master Drawings . Zeichnungen: Los n os 152, 155, 193, 194, 201, 203, 205, 208, 278, 279, 283, 285, 288, 294/296, 298/300, 303/306, 309, 318, 352. 2004, 6. Mai, Neu York, Swann, Sale 2005. Alter Meister durch zeitgenössische Drucke . Mehrere alte Drucke. 2005, 24. Januar, New York, Swann, Verkauf 2030. Zeichnungen alter Meister . Mehrere Zeichnungen von Holtkott. 2005, 3. November, New York, Swann, Verkauf 2055. Alter Meister durch moderne Drucke . Mehrere alte Drucke von Holtkott. 2007, 29. Januar, New York, Swann, Verkauf 2101. Zeichnungen alter Meister und Rembrandt-Radierungen . Mehrere Zeichnungen von Holtkott. 2007, dem 21. Juni, New York, Swann, Verkauf 2119. Entdeckung Verkauf : Drucke und Zeichnungen . Mehrere alte Drucke von Holtkott.
Die Sammlung von Zeichnungen und Drucken Sammlung: L.4266
Gisela Holtkott war nicht etwa als Schlachtenbummlerin in Sachen Fußball unterwegs. Dass sie sich in der Schweiz aufhielt, hatte andere Gründe. Die Berlinerin erholte sich im Seehotel »Hirschen« ihrer Schwiegermutter von einer Krankheit.
Das Haus befand sich in Gunten am Thuner See, direkt gegenüber von Spiez, an der anderen Uferseite gelegen. Die damals 36-Jährige war täglich mit dem Schiff unterwegs. Vom Dampfer aus konnte sie Sepp Herberger und die deutschen Fußballer beim Training beobachten.
Jetzt, fünfzig Jahre später, holten die Ereignisse von damals die Seniorin wieder ein. Im Film »Das Wunder von Bern« ist nämlich der »Hirschen« zu sehen. Die edle Herberge diente dem Regisseur des Streifens als Kulisse für den Kino-Hit über die Fußball-Weltmeisterschaft 1954. »Das Belvédère eignete sich nicht, denn es liegt am Berg hoch über dem Ufer«, berichtet Gisela Holtkott.
Link: Nach dem Sieg setzt beim HFV der Boom ein
Link: Die untergegangenen Gärten von Schloss Bedburg
Neugieriger Blick in die Firmenakten | Kölner Stadt-Anzeiger
Während der Siebenjährige mit seinen Kumpels um den Ball holzte, nahm in der Schweiz Gisela Holtkott die Huldigungen einer Gruppe von etwa 15 Engländern entgegen. Die Touristen waren zu ihr in die Hotelhalle getreten, wo sie am Radio die Endspielübertragung aus dem Berner Wankdorf-Stadion zwischen Ungarn und Deutschland verfolgte.