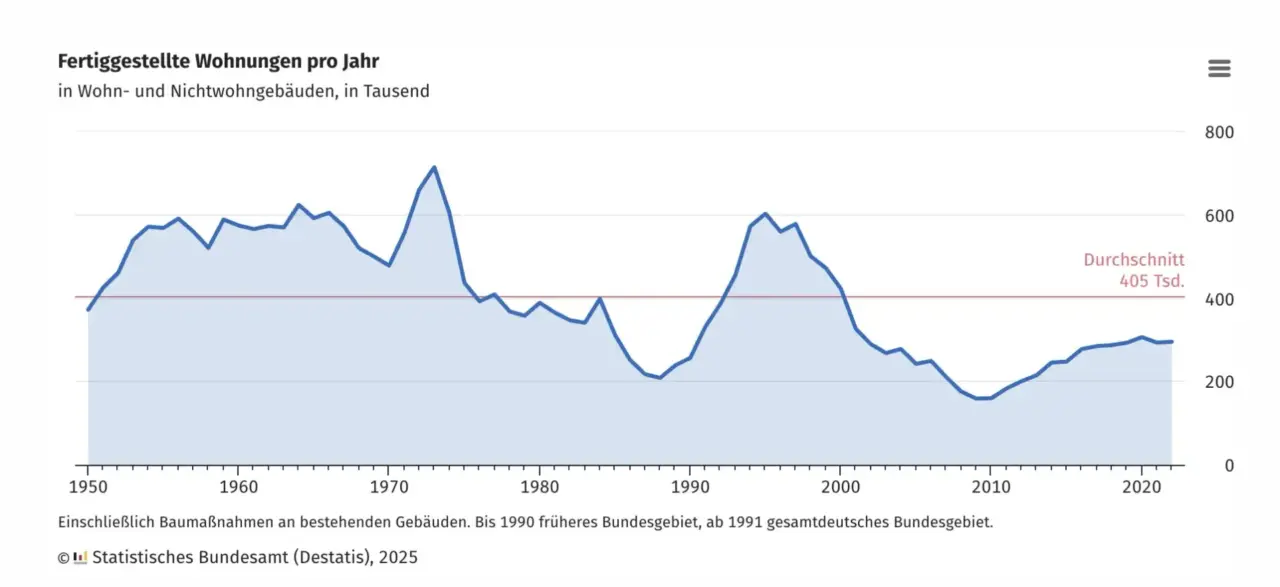Es ist einer dieser Morgen. Der Kaffee ist stark, die Nachricht auch. Da ist er wieder. Donald J. Trump. Wie ein schlecht abgedrehter Werbespot, der sich in unsere Medienlandschaft eingebrannt hat – laut, überdreht, absurd. Nur dass dieses Mal nicht ein Müsli beworben wird, sondern der Untergang. Jedenfalls der der Demokratie.
Kaum ein anderer Politiker schafft es, so zuverlässig und so penetrant die Weltöffentlichkeit zu beschäftigen – und das ganz ohne Sinn und Verstand. Jedenfalls glauben das seine Gegner. Mittlerweile gibts es die “Verschwörungstheorie”, Trumps Gebaren sei Teil eines Plans. Man liest immer wieder darüber. Ob man das Faktum noch als Verschwörungstheorie einordnen darf? Wie dem auch sei: Es wirkt so, als hätte man einem pubertären Klassenclown den Pausenhof gesperrt und ihm die Lautsprecheranlage überlassen.
Doch warum reden wir – also wir Deutschen, das Land der Gartenzwergmentalität und TÜV-zertifizierten Empörung – eigentlich so viel über ihn?
Erstens: Trump ist das perfekte Schreckgespenst. Eine Art politischer Halloween-Kürbis mit orangefarbener Haut und gelben Haaren, der täglich wieder herausgeholt wird. Er ist die Verkörperung all dessen, was uns Angst macht und gleichzeitig fasziniert: fehlende Bildung mit Selbstbewusstsein, Lüge mit Sendungsbewusstsein, Macht ohne Maß.
Das lässt sich so schön ablehnen. So moralisch und intellektuell überlegen empört es sich doch gleich viel besser. Wir fühlen uns aufgeklärt, wenn wir uns über ihn aufregen. Trump ist unser täglicher Ablasshandel – eine Sünde, die wir nicht begangen haben, aber gerne verteufeln.
Zweitens: Er liefert. Ständig. Während andere Politiker sich mühsam um Worte winden, haut er raus, was der Algorithmus verträgt. Und weil unsere Medienwelt wie ein schlecht gelaunter Teenager funktioniert – ständig hungrig, leicht zu triggern und nie satt –, wird jeder noch so absurde Trump-Moment zum Brennstoff für den nächsten Empörungscocktail.
Drittens: Er wirkt global. Trump ist längst keine amerikanische Provinzposse mehr. Seine politischen Nachahmer tummeln sich wie schlecht kopierte PDFs auf dem gesamten Globus. Von Bolsonaro bis Orbán, von Johnson bis Weidel. Man kann ihn nicht ignorieren, weil sein Schatten bis in unsere Biergärten reicht.
Und, ja vielleicht, gibt es da noch einen tieferen Grund. Einen unausgesprochenen: Trump ist wie ein Autounfall auf der Autobahn. Man möchte nicht hinsehen. Man sollte nicht hinsehen. Aber man kann nicht anders. Die Medien wissen das. Wir wissen das. Und er weiß es am allerbesten.
Trump ist die Kardashian der Weltpolitik: Man versteht nicht, warum er da ist. Aber da ist er. Mit goldener Krawatte, aufgerissenen Augen und einem Truth-/X-Account. Möge er an seiner Wahrheit ersticken!
Kurzum:
Er ist da, weil DIE (oder wir?) ihn da haben wollen. Als Reizfigur, als Spiegel, als tägliche Dosis Wahnsinn im Infotainment-Kreislauf. Vielleicht redet man also gar nicht nur über Trump. Vielleicht redet man – auf eine etwas tragische, komische Art – über sich selbst.
In der gestrigen Ausgabe von Maischberger (20. Mai 2025) teilte Peer Steinbrück eine persönliche Anekdote über seine morgendlichen Gespräche mit seiner Frau bezüglich Donald Trump. Er berichtete, dass seine Frau ihn fast jeden Morgen mit den neuesten „Verrücktheiten von Trump“ konfrontiere. Steinbrück äußerte dabei seine Genervtheit über die ständige Präsenz Trumps in ihren Frühstücksgesprächen.
Diese Bemerkung unterstreicht, wie sehr Trumps Verhalten nicht nur die politische Bühne, sondern auch den privaten Alltag beeinflusst. Steinbrücks Kommentar spiegelt eine weit verbreitete Frustration über die anhaltende Dominanz Trumps in den Medien und öffentlichen Diskussionen wider.
Für weitere Einblicke in die Sendung und Steinbrücks Aussagen können Sie die vollständige Episode in der ARD-Mediathek ansehen.