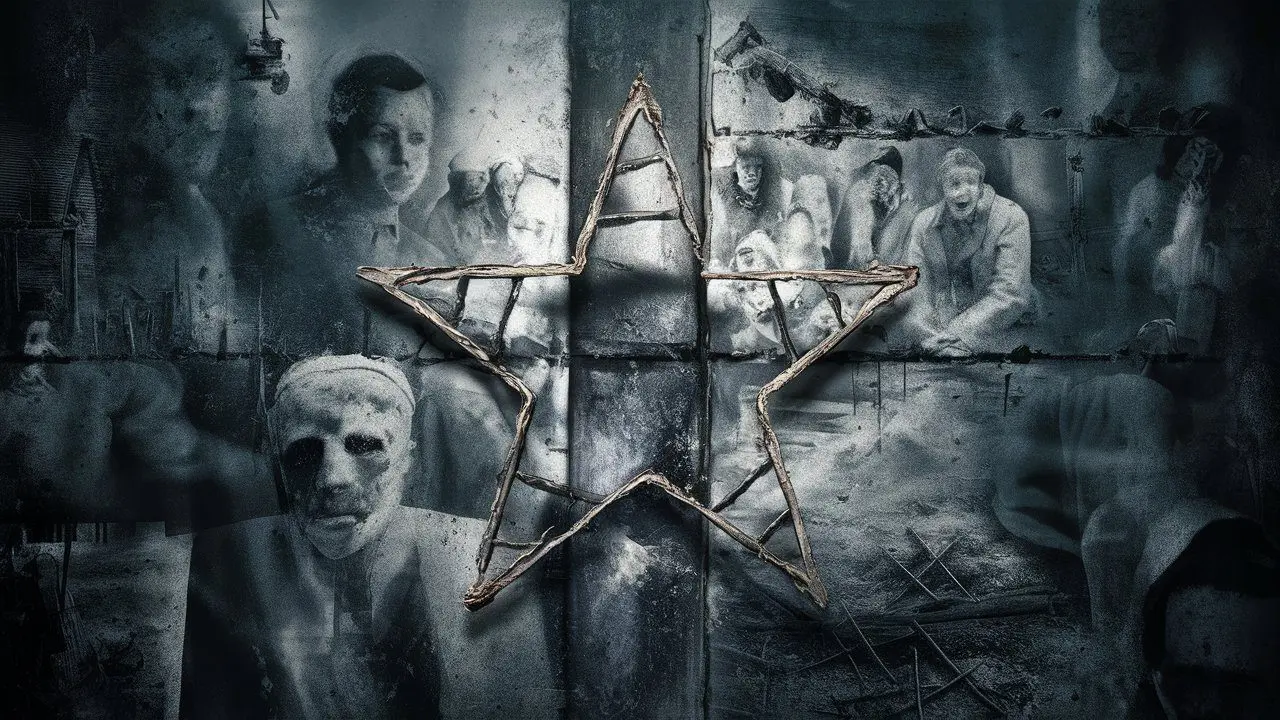
Die Frequenz der Erinnerung: Was Schule und Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk wirklich leisten.
Eva Berendsen hat heute im Spiegel den Beitrag „Wie auf TikTok die Wahrheit über den Holocaust verloren geht“ veröffentlicht. Das Thema beschäftigt mich mein ganzes Leben. Natürlich weiß ich, was in diesem Kontext in den asozialen Netzwerken an Ungutem läuft.
Im öffentlichen Diskurs keimt immer wieder die Frage auf, ob die Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus in Deutschland noch ernst genug genommen wird – gerade in Zeiten, in denen es kaum noch Zeitzeugen gibt und die sogenannte »erinnerungspolitische Wende« (von ganz rechts) gefordert wird.
Manche Stimmen suggerieren, der Holocaust sei zu einem Alibi-Thema verkommen, das einmal jährlich am 27. Januar abgehandelt wird, um den Rest des Jahres Ruhe zu haben.
Meine Recherchen der zwei wichtigsten Säulen der deutschen Erinnerungskultur – die Schule und der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk (ÖRR) – zeigen jedoch eher, dass das Gegenteil der Fall ist. Die Frequenz, mit der die Geschichte des Holocaust vermittelt wird, ist systematisch hoch und fest im Fundament der Bildungs- und Medienlandschaft verankert.
Das Fundament: Der Holocaust als Pflichtfach in der Schule
Die Behauptung, das Thema werde nur am Rande erwähnt, ist durch die Lehrpläne der 16 Bundesländer widerlegt.
Die Systematik der Kultusministerkonferenz (KMK)
- Zweifache Verankerung: Die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust ist in der Regel zweimal im Pflichtunterricht der Schülerinnen und Schüler vorgesehen: vertiefend in der Sekundarstufe I (meist Klasse 9/10) und erneut in der gymnasialen Oberstufe.
- Fächerübergreifender Auftrag: Das Gedenken beschränkt sich nicht auf das Fach Geschichte. Es ist ein fächerübergreifendes Querschnittsthema, das von Deutsch (Literarische Zeugnisse) über Ethik/Religion bis zur politischen Bildung reicht.
- Der Ort als Lehrmittel: In vielen Bundesländern sind Besuche von Gedenkstätten (wie Dachau oder Bergen-Belsen) fest im Lehrplan vorgeschrieben. Das physische Erleben des Ortes ist dabei ein unersetzlicher Baustein der didaktischen Vermittlung.
Die KMK arbeitet zudem kontinuierlich mit Organisationen wie Yad Vashem zusammen, um die Vermittlungsmethoden dem Wandel der Generationen anzupassen. Im Schulsystem ist das Thema somit kein Zufallsprodukt, sondern eine systematische Daueraufgabe.
Die mediale Präsenz: Der ÖRR sendet nicht nur am 27. Januar
Die öffentlich-rechtlichen Sender (ARD, ZDF, 3Sat, arte, Regionalsender) haben den gesetzlichen Auftrag zur historisch-politischen Bildung. Dies schlägt sich in einer hohen Frequenz der Berichterstattung nieder. Ich habe heute beide Sender (ARD und ZDF) angeschrieben, um genauere Daten (Sendetermine) zu erhalten.
Die geballte Frequenz: Der Gedenktag als Programmgewalt
Der 27. Januar (Internationaler Holocaust-Gedenktag) ist der größte jährliche Programmschwerpunkt. Wer das Programm an diesem Tag verfolgt, sieht eine massive Konzentration von Inhalten:
- Prime Time: Dedizierte Dokumentationen, historische Spielfilme oder Themenabende im Hauptprogramm.
- Themenkanäle: Sender wie ZDFinfo oder arte senden oft ganztägige Dokumentations-Schleifen, die sich ausschließlich dem Themenkomplex widmen.
- Nachrichten und Magazine: Intensive Berichterstattung in allen aktuellen Sendeformaten, oft mit neuen Recherchen, Zeitzeugenberichten oder Diskussionen.
Die strukturelle Frequenz: Das ganze Jahr über
Die Frequenz ist jedoch nicht auf diesen einen Tag begrenzt. Die Erinnerungsarbeit läuft im ÖRR kontinuierlich:
- arte und 3Sat: Als europäische Kultur- und Bildungssender haben sie den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg strukturell im Programm verankert. Die Häufigkeit an Dokus zu diesen Themen ist hier ganzjährig sehr hoch.
- Regionalsender (Die Dritten): Hier liegt der Fokus oft auf der lokalen Aufarbeitung von NS-Verbrechen, Verfolgung und Widerstand in der jeweiligen Region. Diese regionalen Beiträge laufen das ganze Jahr über in den Dritten Programmen der ARD.
Die Zählung als Beweis der Verantwortung
Es ist verständlich, dass die Frage nach der exakten Zahl der Beiträge gestellt wird – schließlich geht es um die Überprüfung der Systematik. Eine exakte „Strichliste“ aller Beiträge (vom 30-sekündigen Nachrichtenbeitrag bis zur 90-minütigen Doku) zu erstellen, ist für die Sender eine immense Aufgabe. Das wäre die Recherche, wegen der ich heute an den ÖRR geschrieben habe.
Unabhängig von dieser genauen Zahl ist jedoch klar:
- Der Holocaust ist verpflichtender Kern der deutschen Schulbildung.
- Er ist struktureller Dauerbestandteil der politischen und historischen Berichterstattung im ÖRR.
Die eigentliche Herausforderung der Erinnerungskultur liegt heute nicht in der Quantität der Berichterstattung, sondern in ihrer Qualität – wie gelingt es, die historische Relevanz an junge Generationen zu vermitteln, wenn die letzte Zeitzeugen-Generation verstummt? Dass das Thema bei den asozialen Netzwerken nicht gut aufgehoben ist, versteht sich für mich von selbst. Frau Berendsen hat da einen wichtigen Punkt angesprochen. Die TikTok-Bemühungen scheinen im Sande zu verlaufen. Ich denke an die leider erfolgreichen Auftritte von AfD-Größen in diesem Umfeld und daran, wie sehr die Informationsbeschaffung sich zügig von den linearen Sendern weg entwickelt hat.
Die hohe und systematische Frequenz in Schule und ÖRR beweist, dass Deutschland sich seiner Verantwortung bewusst ist. Die Debatte muss sich nun darauf konzentrieren, dass diese Frequenz nicht nur ein Ritual, sondern eine aktive, zukunftsorientierte Bildungsarbeit bleibt. Das Thema sollte nicht zwangsläufig aus den asozialen Netzwerken herausgehalten werden. Aber besser wär’s, finde ich.
Die Diskrepanz der deutschen Erinnerungskultur
Trotz aller Anstrengungen in der historischen Aufarbeitung bleibt die Frage, ob die deutsche Gesellschaft tatsächlich Lehren aus ihrer Geschichte gezogen hat, erschreckend offen. Die Realität spricht eine härtere Sprache: Die Notwendigkeit von dauerhaftem Polizeischutz für jüdische Einrichtungen und Gläubige in diesem Land ist ein unmissverständliches Indiz für das Versagen der Erinnerung. Die entsetzlichen Vorkommnisse des 7. Oktober und die Reaktion darauf mit öffentlichem Feiern der Ermordung und Schändung jüdischer Menschen in Teilen deutscher Großstädte – offenbaren eine grauenhafte, fast unaussprechliche Ignoranz.
In dem Land der Täter wird eine verfehlte Toleranz gegenüber Zuwanderern geübt, die das Fundament der Erinnerungsverpflichtung untergräbt. Diese Entwicklung ist inakzeptabel und darf sich niemals wiederholen.
Entdecke mehr von Horst Schulte
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.



Hier im Blog werden bei Abgabe von Kommentaren keine IP-Adressen gespeichert! Deine E-Mail-Adresse wird NIE veröffentlicht! Du kannst anonym kommentieren. Dein Name und Deine E-Mail-Adresse müssen nicht eingegeben werden.