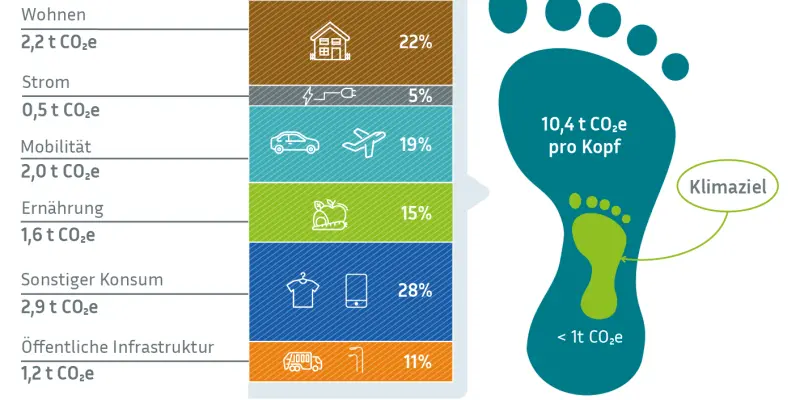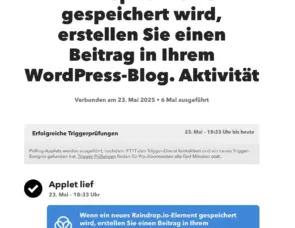Neu ist die Information nicht: In Deutschland gibt es 3 Mio. junge Menschen ohne Berufsabschluss. Was auch immer das im Vergleich zu früher ™ bedeuten mag, mich beunruhigt die Nachricht immer wieder neu, seit ich sie zum ersten Mal hörte. Gestern sprach die Gewerkschaftsvorsitzende der IG Metall, Christiane Brenner, bei Carmen Miosga darüber. Ich hatte das Gefühl, sie würde am liebsten Politik für diese Ungeheuerlichkeit verantwortlich machen und nicht die Betreffenden selbst. So ist das oft in unserem Land!
Heute hat Carsten Linnemann bestimmt wieder viel Freude, wenn er die kritischen Einlassungen größerer Teile unserer Arbeitnehmerschaft am Hals hat. Aber er hatte – selbstredend – damit angefangen. Schließlich stand er für den Unions-Behauptung ein, wir (die Deutschen) müssten mehr arbeiten. Oh, das kommt nicht gut. Und Linnemann weiß das.
Wenn ich als Rentner mich auf solche Diskussionen einlasse, muss ich mit dem Schlimmsten rechnen. Was nehme ich mir heraus, wenn ich zu für mich abstrakten Fragen überhaupt äußere? So in etwa denken viele.
Ich hatte 2014 nach ungefähr 47 Jahren und Motivationsproblemen keinen Bock mehr zu arbeiten und fand für mich einen Ausweg, der nur durch die SPD, besser gesagt, Frau Nahles gangbar war. Ja, die Rente mit 63. Heute, wenn nur das Wort darauf fällt, ist dies eine Provokation. Jedenfalls für die Vielen, die überzeugt davon sind, Alte würden bevorzugt. Na, und das stimmt ja auch. Wer möchte das allerdings schon zugeben?
Mir ist im Gegensatz zu vielen Zeitgenossen aufgefallen, wie sich die Arbeitsmoral während meiner vielen Arbeitsjahre verändert hat. Jetzt lacht nicht, ich war natürlich immer eine Speerspitze für Arbeitseifer und -moral.
Als Abteilungsleiter hatte ich einen gewissen Überblick. Nicht nur über »meine Leute«, sondern auch durch den naturbedingten Austausch mit anderen Personalverantwortlichen. Deshalb kann ich mir ein Bild machen und erlaube mir, darüber zu sprechen.
Ich beobachtete, wie sich die Anzahl der Jahresurlaube (nicht nur bei mir) vermehrte. Schließlich lagen wir bei drei Auslandsaufenthalten (Flügen) oder zwei und dafür gings einmal ins Sauerland oder die Eifel. Darunter machte man es nicht mehr. Die schamlose Nutzung von Brückentagen nahm derweil auch in Behörden und bei Ärzten immer weiter zu. Hatte man Pech, hatten sich die Leute aus dem üppigen Jahresurlaubskonto eine Woche zurückgestellt, um diese Chance weidlich auszunutzen und sich ein sogenanntes langes Wochenende zu gönnen. Die wenigen Arbeitssamen durften sich mit Mehrbelastung und Frust herumschlagen, während andere der selbstverständlichen Nutzung von MEHR FREI widmeten.
Ich hatte lange Jahre das Privileg, die Inventur unseres Unternehmens nicht zu begleiten und zu überwachen, sondern selbst mitzuzählen. Gott, war das schön. Zwischen den Tagen (also Weihnachten und Silvester) hatte ich nie frei, viele andere allerdings sehr wohl. Und die wurden über die Jahre immer mehr. Entsprechend zäh war der Kampf zwischen denen, die dabei unverzichtbar schienen und denen, die mal locker ein Jahr im Voraus ihren Urlaubsanspruch für diese kritische Zeitspanne anmeldeten. Mir ist immer wieder passiert, dass ich Urlaubsanträge von Leuten abgezeichnet habe, die ich eigentlich (für die Inventur) gut hätte gebrauchen können. Aber sie hatten nun mal Besseres zu tun. Urlaub machen ist halt das Lebenselixier für ganz viele Arbeitnehmer. Ich hingegen war manchmal sogar froh, wenn ich endlich wieder arbeiten durfte. Ja, so war ich. Bis ins letzte Arbeitsjahrzehnt hinein.
Ich habe gemerkt, dass ich als über 60-Jähriger nicht mehr so richtig in der Szene war. Möglicherweise lag es am Altersdurchschnitt im Unternehmen, möglicherweise hatte ich aber auch immer weniger Bock, auf diesem Niveau (wie früher) weiterzumachen. Außer gesundheitlichen Fehlalarmen war die Motivation durch die Führung des Unternehmens maßgeblich für meine zunehmend mangelhafte Einstellung zur Arbeit.
Das hatte ich in vielen Jahrzehnten zuvor NIE gekannt. Nun, immer wieder gab es Zeiten, in denen ich nicht mindestens 10 Stunden gearbeitet hätte. Oft waren es 12 und mehr Stunden täglich. Dann habe ich mir von jüngeren Kollegen anhören müssen, dass ich da wohl etwas falsch machen würde. Sonst wäre ich in 8 Stunden fertig mit meiner Arbeit. Ja, ja. Solche Sprüche habe ich geliebt und selten, aber auch selbst manchmal benutzt – in Mitarbeitergesprächen. Was für ein Scheiß!
Wenn ich höre, wie dringend Rentner auf unserem Arbeitsmarkt benötigt werden und die Rente mit 63 so ein schwerer Fehler gewesen wäre, muss ich mich immer zur Ruhe zwingen. Haben sich die Leute in den Chefetagen unserer Firmen mal Gedanken darüber gemacht, weshalb so viele diese Chance auf vorzeitigen Ausstieg nicht entgehen ließen? Das Signal in unseren Unternehmen geht doch eindeutig und viel zu häufig gegen ältere Mitarbeiter. Natürlich gibt es Ausnahmen.
Ich hätte mir gewünscht, als anerkannter, geschätzter Mitarbeiter aus dem Dienst zu scheiden, wenn man das so sagen kann. Stattdessen weiß ich: Die waren froh, als sie mich los waren. Und so ist es ganz vielen anderen auch ergangen. Auch heute geht mir deshalb das Gequatsche voll auf den Zeiger, wenn nicht nur die Rente mit 63 mies gemacht, sondern auch so getan wird, als würden Mitarbeiter über 60 doch sooo geschätzt. Blödsinn! Die möchten die Alten möglichst preiswert loswerden. Das ist alles.
Trotz dieser Einstellung zu denen, die es immer noch zum größten Teil in der Hand haben (ja, ich meine natürlich die Unternehmer!) weiß ich, dass die Entwicklung im Land eine unheilvolle Richtung genommen hat. Mehr als genug bilden sich ein, sich zum Beispiel mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder ganz ohne Kapitalismus aus der Misere befreien zu können. Bullshit!
Wenn wir auch nur annähernd den gewohnten Lebensstandard halten wollen, muss viel geschehen. Ja, es muss wieder mehr gearbeitet werden. Und es wird nicht klappen, wenn wir bei jedem Problem nach dem Staat rufen. Der hat nämlich bald sehr viel weniger Geld in den 2010er Jahren. Ich glaube, viele haben das nicht verstanden und denken, dass trotz allem irgendwie schon alles weiterlaufen wird.
Ich denke, uns stehen schwere Zeiten bevor. Gerade wegen dieser Denkweisen. Viele wissen oder ahnen das. Dass sie dieses Wissen nicht reflektieren und stattdessen weiter so tun, als könne man die vielen Baustellen und Missgriffe in unserem Land kaschieren und dies bliebe ohne Auswirkung für sie, ist schon eine Meisterleistung in Sachen Selbsttäuschung.
Wir sind ein Haufen verwöhnter Menschen, die, wenn es um Ehrlichkeit und nötige Einsichten in notwendige Veränderungen geht, kneifen oder sogar auf die Barrikaden gehen – verbal zumindest. Keiner will Verantwortung übernehmen (s. Politik) und arbeiten wollen die meisten am liebsten nur noch 4 Tage und das bei vollem Lohnausgleich. Der Letzte macht das Licht aus.