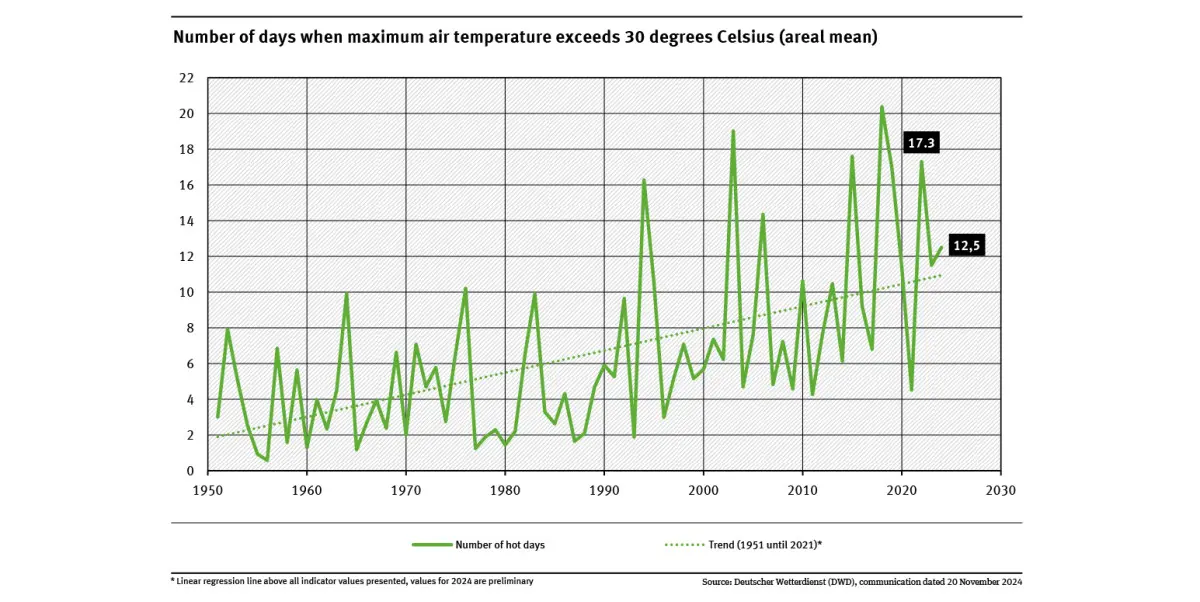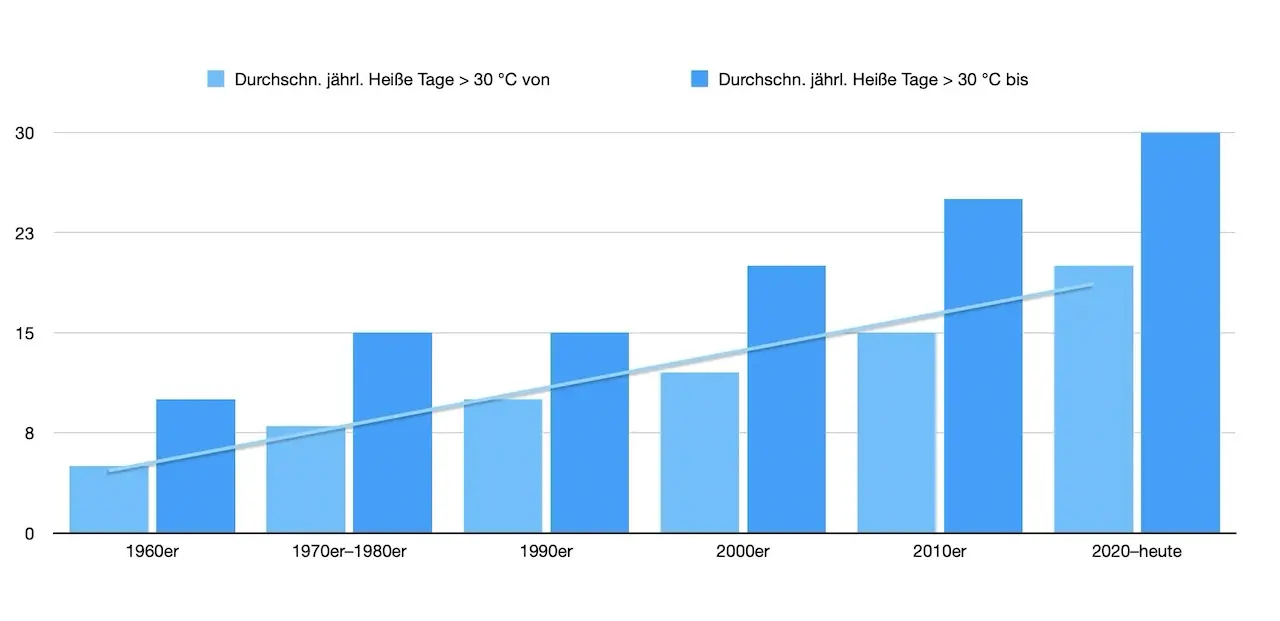Die Richterin und der Mob
Was bleibt von einem Menschen, wenn man ihn nicht mehr als Menschen sieht?
In diesen Tagen ist viel geschrieben worden über Paragrafen, Wahlausschüsse, Fraktionslogik und Medienkampagnen. Über Richtlinienkompetenz, verfassungsrechtliche Eignung, Plagiatsvorwürfe. Doch viel zu wenig wurde darüber gesprochen, was all das mit einem Menschen macht. Was es bedeutet, wenn sich der politische Hass Bahn bricht und ausgerechnet jene trifft, die für das Recht eintreten.
Ich möchte darüber schreiben, was mich an der Kampagne gegen Frauke Brosius-Gersdorf wirklich erschüttert. Es ist nicht nur die politische Feigheit derer, die sich vor sie hätten stellen müssen. Es ist nicht nur die widerwärtige Rhetorik aus rechten Medienlagern, in denen sie als „linksradikale Verfassungsfeindin“ gebrandmarkt wird. Es ist die kalte, kaltschnäuzige Art, mit der über sie gesprochen wird – als sei sie ein Fall. Ein Hindernis. Eine Schachfigur.
Sie ist ein Mensch.
Die Erinnerung an einen TV-Abend
Ich sah sie zum ersten Mal bei Markus Lanz, zusammen mit Gerhart Baum und Heribert Prantl. Es ging um das AfD-Verbotsverfahren – ein schwieriges, emotional aufgeladenes Thema. Und da saß sie: ruhig, klar, ohne jeden ideologischen Überschwang. Juristisch präzise, aber nicht abgehoben. Aufmerksam, aber nicht belehrend. Es war ein beeindruckender Auftritt, weil er etwas zeigte, das heute selten geworden ist: Überzeugung ohne Rechthaberei. Eine Formulierung hat sie gestern (bei Lanz) geradegerückt. Ich bin sicher, dass sie damit NICHT durchdringen konnte. Nicht bei denen, die längst ihr Urteil gefällt haben.
Dass ausgerechnet dieses Thema – das AfD-Verbot – später zum Brandbeschleuniger für die Hetze gegen sie wurde, ist nur folgerichtig. Die Rechtsextremen in diesem Land spüren sehr genau, wer ihnen gefährlich werden könnte. Und wer noch das Vertrauen der bürgerlichen Mitte genießt.
Eine Frau wird zur Zielscheibe
Seit ihrer Nominierung zur Verfassungsrichterin wurde Brosius-Gersdorf zur Zielscheibe einer diffamierenden, entmenschlichenden Kampagne. Ihre Worte wurden verdreht, ihre Wissenschaftlichkeit angezweifelt, ihre Loyalität infrage gestellt. Aus einer Juristin wurde eine „Aktivistin“, aus einem Gutachten eine „Agenda“, aus ihrer Familie ein potenzielles Druckmittel.
Und dann wurde es ganz still.
Still auf Seiten derer, die es hätten besser wissen müssen.
Was das mit einem Menschen macht
Meine Frau und ich haben sie noch einmal gesehen – wieder bei Markus Lanz, diesmal nach den Vorwürfen. Man konnte sehen, was diese Tage mit ihr gemacht haben. Wie schwer das Atmen fällt, wenn Worte plötzlich Waffe werden. Wenn nicht mehr diskutiert wird, sondern verurteilt. Wenn Drohbriefe ins Haus flattern. Wenn die Kollegen an der Universität nicht nur Mails mit schlimmen Inhalten lesen, sondern Polizeischutz brauchen.
Es ist schwer, das zu schreiben, ohne wütend zu werden.
Denn wer sich einmal fragt, wie Demokratien zerfallen, der muss nicht auf die große Gewalt warten. Es beginnt mit Verachtung. Mit dem Missbrauch der Sprache. Mit dem systematischen Entzug von Empathie.
So war es in den letzten Jahren der Weimarer Republik. So ist es wieder.
Das Ende der Menschlichkeit als Methode
Tichy, Reichelt, Reitz, Fleischhauer – sie führen diese Angriffe mit der eiskalten Präzision professioneller Populisten. Sie bedienen sich am Arsenal der alten Demagogen: Verdacht säen, Sprache verzerren, Schuld zuweisen. Ihre Agenda ist klar: diese Regierung delegitimieren, jeden Widerstand brechen, das Vertrauen in unsere Institutionen zersetzen.
Dass Brosius-Gersdorf nicht nur Juristin, sondern auch Ehefrau, Kollegin, Freundin, Professorin ist – interessiert sie nicht. Für solche Leute ist sie ein Symbol. Und Symbole darf man vernichten.
Die Verantwortung liegt bei uns
Ich schreibe diesen Text, weil ich glaube, dass wir nicht nur über Politik sprechen dürfen, sondern auch über Haltung. Und über Menschlichkeit.
Frauke Brosius-Gersdorf verdient Schutz. Nicht nur, weil sie fachlich über jeden Zweifel erhaben ist. Sondern weil sie mit Würde und Klugheit etwas verkörpert, das viele schon verloren haben: Anstand im öffentlichen Raum.
Wer sie mundtot machen will, will uns alle mundtot machen. Und das darf nicht gelingen.
—-
P.S.: Ich wünschte, Brosius-Gersdorf würde diesen Sturm durchstehen. Ich fürchte, dass sie das nicht schafft. Sie wird vermutlich auf das Amt verzichten. Sie hat in der Sendung bei Markus Lanz gesagt, worum es ihr geht. Viele haben nicht zugehört.