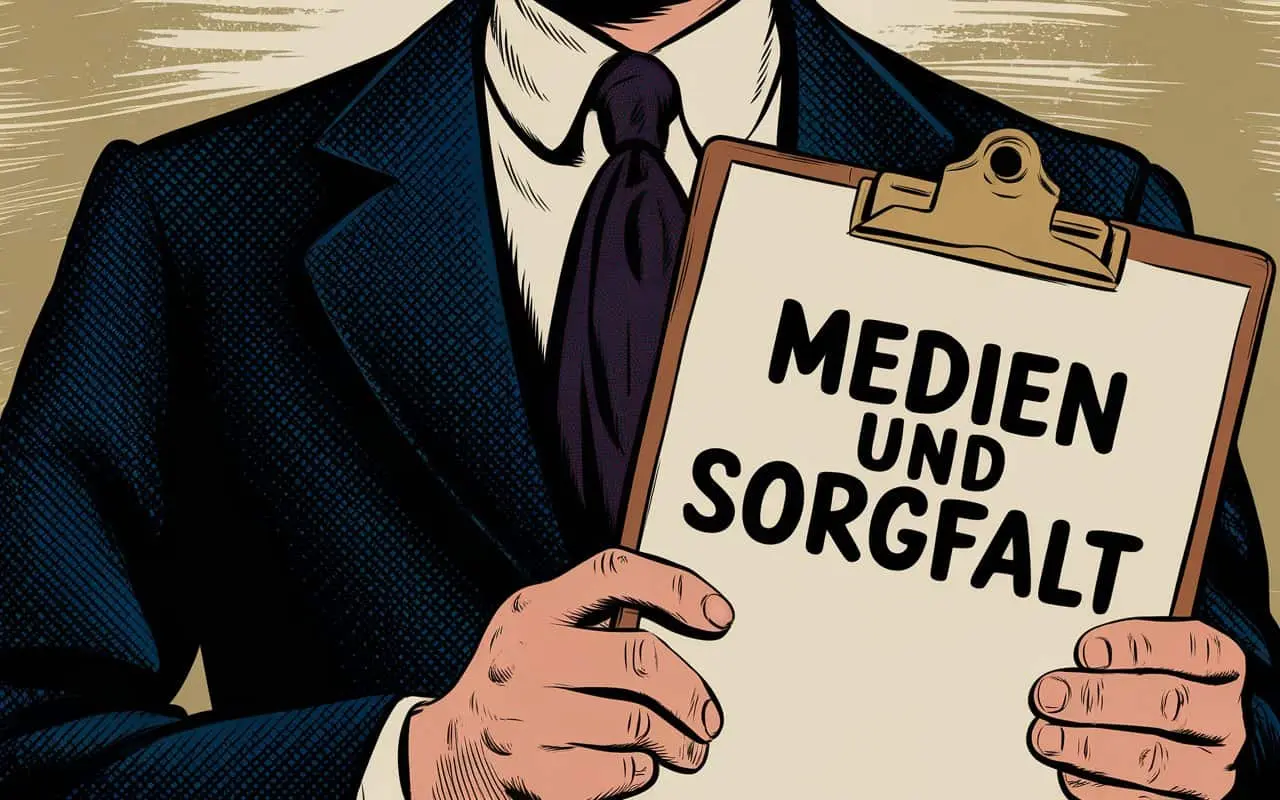Carsten Linnemann, einer der engsten Vertrauten von Friedrich Merz und lange als Favorit für das Wirtschaftsministerium gehandelt, hat sich bewusst gegen ein Ministeramt entschieden. Stattdessen will er als Generalsekretär den begonnenen Erneuerungsprozess der CDU weiterführen. In einem Video betonte Linnemann, dass sein „Bauchgefühl“ ihm zu dieser Entscheidung geraten habe – und er als Generalsekretär den Politikwechsel besser vorantreiben könne.
Was könnte hinter Linnemanns Entscheidung stecken?
Man darf sich nicht täuschen lassen: Die Entscheidung kam nicht aus heiterem Himmel, und auch nicht allein aus dem Bauch. Hinter den Kulissen war Linnemann sehr wohl interessiert an einem Ministeramt – insbesondere am Arbeits- und Sozialministerium, das nun an die SPD geht. Auch das Wirtschaftsministerium stand im Raum, doch für den bekennenden Mittelstandsfan und Wirtschaftsexperten Linnemann schien das nicht attraktiv genug zu sein.
Koalitionsarithmetik, nennt man so etwas nüchtern. Wer mitregieren will, muss nehmen, was übrig bleibt. Doch genau das wollte Linnemann offenbar nicht. Seine Entscheidung ist also mehr als nur Ausdruck innerparteilicher Demut – sie ist auch ein Ausdruck strategischer Klugheit.
Einfluss ohne Ministeramt
Denn während Minister kommen und gehen, bleibt der Generalsekretär. Linnemann sitzt künftig im Koalitionsausschuss – dort, wo die politische Linie verhandelt und verfeinert wird. Dort, wo Macht nicht inszeniert, sondern ausgeübt wird.
Mit anderen Worten: Er bleibt im Maschinenraum der Macht, wo die eigentlichen Weichen gestellt werden. Nicht im gleißenden Scheinwerferlicht eines Ressorts – sondern als Architekt im Schatten, wo Pläne geschmiedet und Mehrheiten geformt werden.
Reaktionen: Lob, Irritation und strategische Deutung
Innerhalb der CDU wird dieser Schritt weitgehend begrüßt. Parteichef Merz freut sich über die Entscheidung seines Vertrauten, und auch Jens Spahn spricht von einer „echt guten Nachricht“. Die CDU sendet damit ein Signal der Selbstbehauptung: Wir sind nicht bloß Teil der Regierung, wir haben einen Plan.
Doch außerhalb der Partei sorgt der Schritt für Stirnrunzeln. Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann fragt, was denn da bei der CDU los sei, wo sich doch jemand, der sich öffentlich für ministrabel hielt, nun selbst zurückzieht. Auch das gehört zum politischen Spiel: das Lesen zwischen den Zeilen.
Die CDU jedenfalls scheint auf Kontinuität und Geschlossenheit zu setzen. Auf das stabile Fundament einer Partei, die sich nicht allein über Posten definiert, sondern über Richtung und Haltung.
Was bedeutet das für die CDU?
Linnemanns Verzicht auf ein Ministeramt ist ein Statement: Politikwechsel braucht Geduld – und einen langen Atem. Linnemann will sich nicht verzetteln, nicht aufreiben im Tagesgeschäft eines Ministeriums. Er sagt, er wolle gestalten, aber mit Plan – nicht mit Aktionismus.
Mit Linnemann bleibt eine Schlüsselfigur an Bord, die sowohl das Ohr an der Basis als auch das Vertrauen der Parteispitze hat. Es ist der Versuch, Regierungsverantwortung und parteipolitische Profilschärfung in Einklang zu bringen – eine Kunst, die vielen schwerfällt.
Welche Schlussfolgerung kann man ziehen?
Die NZZ hat ihre Analyse bereits geliefert – in gewohnt skeptischem Tonfall. Dort wird an keiner deutschen Entscheidung ein gutes Haar gelassen. So kennt man es aus Zürich.
Das ist ein klares Misstrauensvotum gegen die künftige schwarz-rote Regierung.
Quelle
Doch jenseits der harschen Urteile bleibt festzuhalten: Carsten Linnemann wird der CDU als Taktgeber erhalten bleiben – nicht auf der Bühne eines Ministeriums, sondern als Strippenzieher und Vordenker im Hintergrund.
Misstrauen gegen Merz? Kaum. Eher die Einsicht, dass die Bühne des Tagesgeschäfts nicht jedem liegt – und man im Feuergefecht der Öffentlichkeit schneller verbrennt, als man denkt. Wer will schon zur Zielscheibe medialer Zermürbung werden, wie weiland Robert Habeck?
Vielleicht hat Linnemann genau dieses Szenario im Kopf. Vielleicht kennt er die Stimmungslage in einer Koalition, die noch nicht einmal geboren, aber schon von Geburtswehen geplagt ist. Sein Schritt wirkt da weniger als ein Rückzug – und mehr als eine kalkulierte Offensive.
Ein Generalsekretär, der weiß, wo er hingehört. Und wann man besser nicht Minister wird. Persönlich bin ich froh über Linnemanns Entscheidung. Er wäre auf dem Chefsessel des Wirtschaftsminister trotz seines Studiums der Volkswirtschaft untergegangen. Inszeniert wird Linnemanns Entscheidung von der CDU möglicherweise als Kontrapunkt auf Merz’ Vorgehen bei der Schuldenbremse.