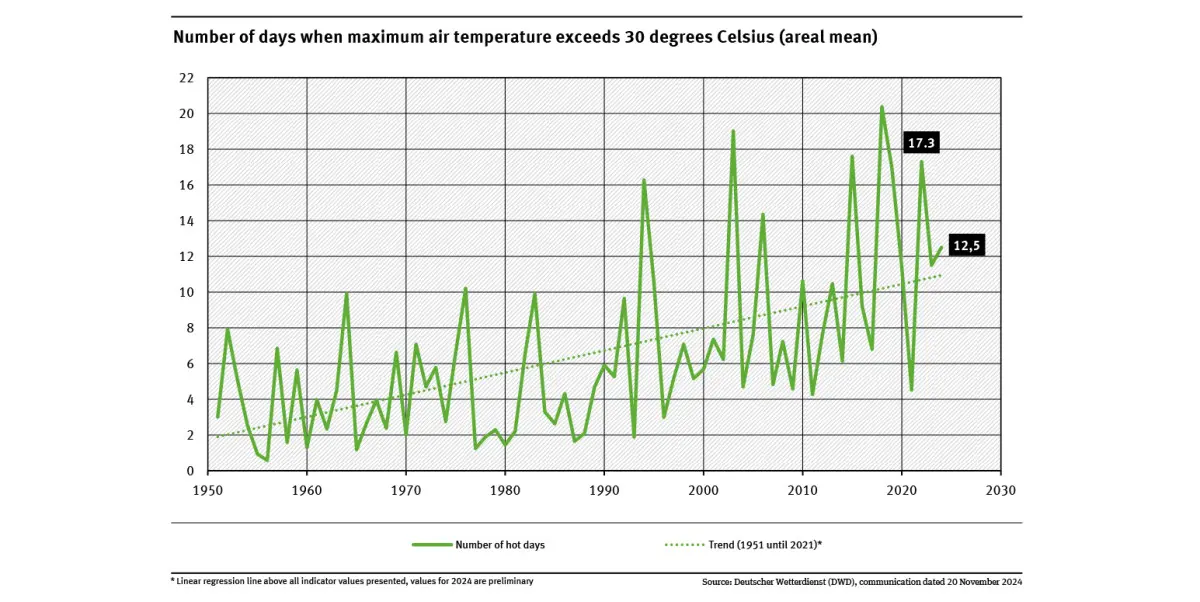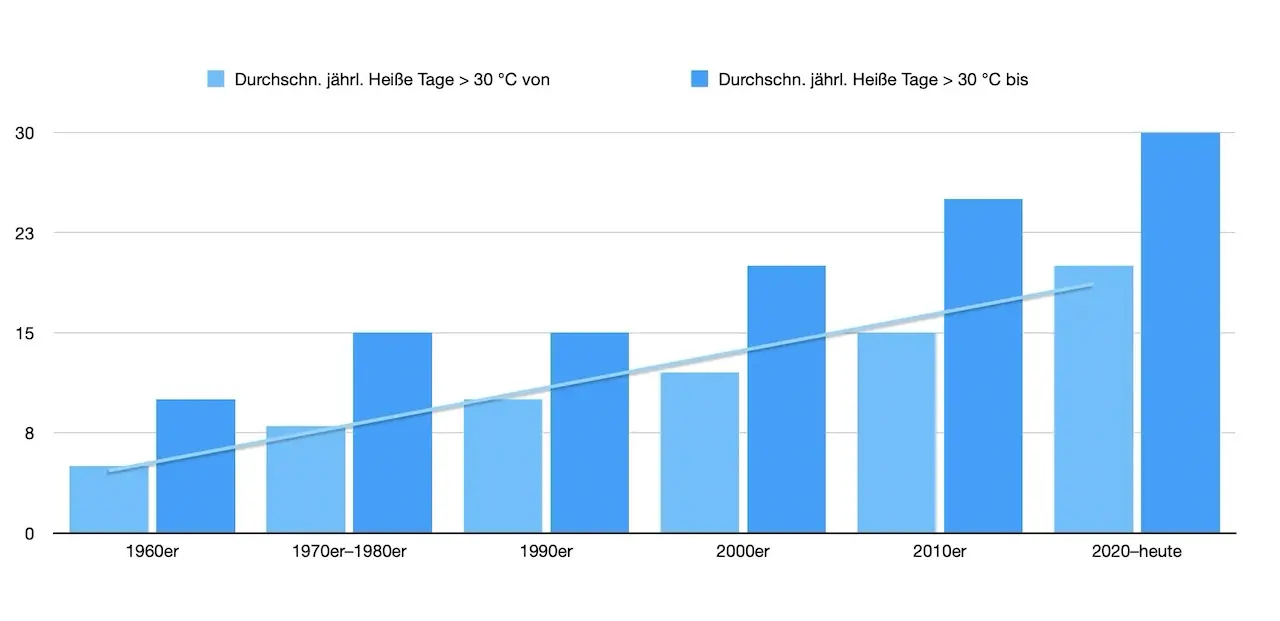“Es geht darum, den Willen der Mehrheitsbevölkerung zu brechen“. Jau, Frau Voss. Eine Nummer kleiner haben Sie es nicht? Wenn ich die Intention dieses Machwerks richtig deute, sagen seine Macher, dass alle “Parteien der Mitte” sich an grundsätzlichen demokratischen Spiegelregeln vergangen haben. Dass jetzt, also nach dem Regierungswechsel, genauso weitergemacht wird, sollte die Macher der “Doku” verstören. Aber halt, nicht nur die AfD redet ja von Systemparteien. Dann passts ja.
Vielleicht sollten Demokraten dem rechten Abschaum mit allen gebotenen Mitteln Paroli bieten! Dieser Meinung können die Macher der Reportage ganz sicher nicht folgen. Vielleicht ist es gut, dass das Machwerk so wenig Resonanz bekommen hat?
Da geistert also dieses „Werk“ von NIUS (“großen Investigativ-Dokumentation”) durch die Timelines: Ein Video, das sich „Dokumentation“ nennt, aber in Wahrheit ein ideologisch aufgeladener Rundumschlag gegen alles ist, was als „links-grün“ gelabelt werden kann, Union wohl inklusive. Verpackt wird das Ganze in sachlich klingende Kommentare, emotionslose Schnittbilder, professionell ausgeleuchtete Interviews. Der Zuschauer bekommt ein Gefühl von Seriosität – obwohl er sich inmitten einer orchestrierten Kampagne befindet.
Was dort gegen NGOs, Medien, Politik und gesellschaftlichen Zusammenhalt ins Feld geführt wird, ist keine neutrale Analyse, sondern eine Rhetorik, die gezielt misstrauisch, spaltend, moralisierend arbeitet. Die Demokratie wird in ein schiefes Licht getaucht – nicht durch offene Feinde, sondern durch Menschen im Maßanzug.
Eine Bühne für rechte Intellektualisierung
Auch irritierend: der Auftritt von RA Joachim Steinhöfel. Er ist offensichtlich inzwischen der Haus- und Hof-Anwalt von Reichelts Gnaden. Kürzlich hatte er ihn erst heraus geboxt, was aus seiner Sicht natürlich ein triumphaler Sieg gegen die verhasste staatliche Bundesinnenministerin Faeser (SPD) war. Der Sieg wurde selbstredend entsprechend ausgeschlachtet. Steinhöfel beschreibt, dass für NGO’s Milliardenbeträge ausgegeben würden, die anderswo fehlen. Er wird wissen, dass die meisten Mittel für die Finanzierung von NGO’s ausgegeben werden, die im Ausland arbeiten. Es handelte sich dort um Milliardenbeträge. Die NGO’s, die die Feindesliste dieser investigativen Richter des Volkes anführen, erhalten weniger Geld. Es wurden in 2023 182 Millionen EURO zur Verfügung gestellt und ca. 165 Millionen EURO ausgegeben. Die seitenlange Projektliste ist beeindruckend.
Die politische Gesinnung schweißt offensichtlich zusammen. Ein Jurist, über den ich als Laiendarstellung schon vor Jahrzehnten überflüssigerweise aufgeregt habe. Heute nutzt er seine Eloquenz und sein anwaltschaftliches Können, um ganz im Duktus des Rechtspopulismus zu „entlarven“. Was er sagt, bleibt formaljuristisch meist im Rahmen. Für einen Juristen natürlich kein Zufall. Doch genau darin liegt das Gift: Meiner Ansicht nach tarnen seine Aussagen sich als Analyse, während sie Narrative bedienen, die nicht etwa auf Rechtsstaatlichkeit zielen, sondern auf ihre Aushöhlung.
Der Zwang, in der öffentlichen Debatte besonders aufzufallen, um so mehr Spenden zu generieren, zwingt Nichtregierungsorganisationen geradezu, moralische Empörung hervorzurufen. Sorgen und Ängste der Menschen würden, so Herfried Münkler 2018, im Gestus der moralischen Empörung von Medienspezialisten der Nichtregierungsorganisationen „bewirtschaftet“.
Quelle
Wenn Steinhöfel von einem „semi-legalen NGO-Komplex“ spricht, suggeriert er mafiöse Strukturen – ohne Belege, ohne journalistische Redlichkeit. Dass er damit die Bühne einer „Reportage“ nutzt, die keinerlei Distanz zum Gesagten wahrt, macht die Sache noch prekärer.
Hier die Aussagen Steinhöfels im Video:
„Wir haben es hier beim NGO-Komplex mit einem Schattengebilde zu tun.“
„Da findet auch eine unfassbare Verschwendung von Steuermitteln statt.“
„Hier wird Gesellschaftspolitik gemacht, und Gesellschaftspolitik legt quasi die Leitplanken fest, was in einem Land gedacht wird. Und was heute tabuisiert wird, kann auch morgen nicht reale Politik werden.“
„Man erschafft ein Klima der Angst, ein Klima der Einschüchterung, wo ganz gezielt versucht wird, Menschen aus dem gesellschaftlichen Leben zu drängen – und zwar mit dem Mittel der Anschwärzung.“
„Wir haben jetzt den Rest der wichtigen Fragen genommen, sie so umformuliert, dass man sie auch vor Gericht geltend machen kann.“
„Der Staat versucht Steuergelder verfassungswidrig zu instrumentalisieren, damit seine Erfüllungsgehilfen in den NGOs die Arbeit für ihn erledigen, die ihm selber verboten ist.“
„Da gehen Milliardenbeträge rein, die wir für andere Dinge wesentlich besser gebrauchen könnten als für die Förderung von politisch einseitigen Programmen.“
„Wenn der Staat diese Gelder verteilt, um Journalismus zu unterstützen, frage ich mich: Wie machtkritisch kann denn ein solcher Journalismus noch sein?“
„Wir reden nicht über Volksverhetzung, sondern über viel schlimmere Dinge – staatsgefährdende Delikte.“
Der ehemalige Präsident des Bundesgerichtshofes, Dr. Thomas Fischer, attestierte Julian Reichelt „kenntnisfreie Panikmache und rechtspolitische Scharfmacherei auf sehr niedrigem Niveau”. Man möchte sagen, dem sei nichts hinzuzufügen. Aber das ist einer, dem man nicht klar genug widersprechen kann.
Eine Empörungswelle bleibt aus
Und wo bleibt die Kritik?
Sie kam – vielleicht kommt sie noch etwas vehementer. Aber sie ist zersplittert, leise, vielleicht sogar erschöpft. All die miesen Nachrichten sorgen eher dafür, dass die “immer miesgelaunten” Deutschen solchen Leuten zustimmen. Jedenfalls, wenn ich mir die Kommentare unter dem YouTube-Video anschaue, könnte man das denken. Ein paar Kommentare auf Twitter (Pardon: X). Sonst nichts? Das alles bleibt wirkungslos gegen die Macht der Vorwürfe und Unterstellungen und den algorithmisch verstärkten Drive solcher Produktionen.
Dass ehemalige Ministerinnen wie Kristina Schröder sich solchen Formaten zur Verfügung stellen, zeigt, wie tief der Bruch mit der politischen Mitte inzwischen reicht.
Wer auf YouTube unterwegs ist, trifft auf Kommentare, die den Tenor des Videos feiern. „Endlich spricht es mal einer aus.“ Doch was wird da ausgesprochen? Kein neues Wissen. Kein fundierter Einblick. Sondern die Wiederholung rechter Talking Points, geschickt ummantelt von Pseudojournalismus.
Keine kritische Öffentlichkeit in Sicht?
Dass sich bislang keine großen Redaktionen öffentlich positioniert haben, lässt tief blicken. Vielleicht, weil man das Produkt für zu plump hält. Vielleicht, weil man sich keine Fehde mit den lautesten Teilen des Internets leisten will. Oder vielleicht, weil es bequem ist, sich nicht einzumischen – solange sich der Hass gegen NGOs und nicht gegen Medienhäuser selbst richtet.
Doch genau diese Bequemlichkeit ist gefährlich. Denn was heute als „Dokumentation“ getarnt viral geht, ist morgen das Fundament politischer Narrative, die nicht mehr hinterfragt werden.
Zeit, die Stimme zu erheben
Wir brauchen keine Zensur. Wir brauchen keine Repression. Deshalb auch keine NGO’s, die auf unsere Demokratie aufpassen! Was wir brauchen, ist eine öffentlich sichtbare, streitbare, faktenbasierte Auseinandersetzung mit Desinformation, auch wenn sie im feinen Gewand daherkommt. Steinhöfel darf sagen, was er will – aber es ist unsere Aufgabe, das einzuordnen, zu widersprechen, aufzudecken.
Was jedoch von NIUS als „Aufklärung“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein Angriff auf den gesellschaftlichen Kitt. So sehe ich da. Man möchte die Parteien, die die Regierung tragen, “vorführen” bzw. deren Maßnahmen ad absurdum führen.
Und wer dazu schweigt, macht sich nicht neutral – sondern überflüssig.
Was erzählt Julian Reichelt im Beitrag?
Er tritt primär als Erzähler und Kommentator auf, seine Aussagen sind deshalb oft paraphrasierend und rahmend. Hier einige typische Aussagen:
„Milliarden Euro Steuergeld sind in den letzten 10 Jahren in den NGO-Komplex geflossen – ein Geflecht von Organisationen, die dem Land eine linke Agenda aufzwingen.“
„Mit Steuergeld greifen die NGOs in den Wahlkampf ein.“
„Der NGO-Komplex holt immer mehr Migranten ins Land und sorgt dafür, dass sie bleiben dürfen.“
„Die NGOs treiben das Land in die Deindustrialisierung.“
„Sie verstehen es wirklich, aus einer Minderheitenposition heraus der Mehrheit ihren politischen Willen aufzuzwingen – das finde ich gefährlich.“
„Steuerfinanzierter Journalismus ist ein Widerspruch in sich.“
„Mit einer perfiden Technik der Insinuation gelang es dem steuerfinanzierten Medium Korrektiv, ein erlogenes Schauermärchen als Wahrheit zu verkaufen.“
„Steuergeld wird verwendet, um die Opposition zu diskreditieren und eine linke Hegemonie zu etablieren.“
„So erschafft der NGO-Komplex eine linke Hegemonie, die eine konservative Wende unmöglich macht und den Willen der Wähler zu brechen versucht.“
Die Zitate habe ich dem Transkript des YouTube-Videos entnommen. Hoffentlich habe ich dabei keine falschen Zuordnungen zu Steinhöfel oder Reichelt vorgenommen.
Mehr zum Thema lesen:
Achtung Reichelt: Nius und die NGO-Verschwörungslegende