Es handelt sich bei meiner Leseempfehlung um einen langen, interessanten Artikel über eine Entwicklung von dem, was wir einst unter dem weitläufigen, so viel verschiedenes umfassenden Begriff “Musik” kennenlernten.
Die Reporterin Liz Pelly recherchiert zu den fragwürdigen Methoden des Unternehmens Spotify. So sollen die beliebtesten Playlists mit Stock-Musik befüllt worden sein, die pseudonymen Musikern zugeschrieben wird – auch Ghost- oder Fake-Künstler genannt –, vermutlich in dem Bemühen, Lizenzgebühren zu senken. Die Autorin geht unter anderem der Frage noch, ob Spotify die Titel möglicherweise selbst erstellt.
The Ghosts in the Machine (harpers.org, Englisch)Newsletter: Correctiv
Ich nutze “Spotify” exzessiv. Ich frage mich, wie stark die Nutzung des Streamingdienstes für mich selbst schon die Seele dessen, was ich als Musik kennen und lieben lernte, verändert hat. Vielleicht so, wie es die Techniken, die im Artikel beschrieben werden, nahelegen?
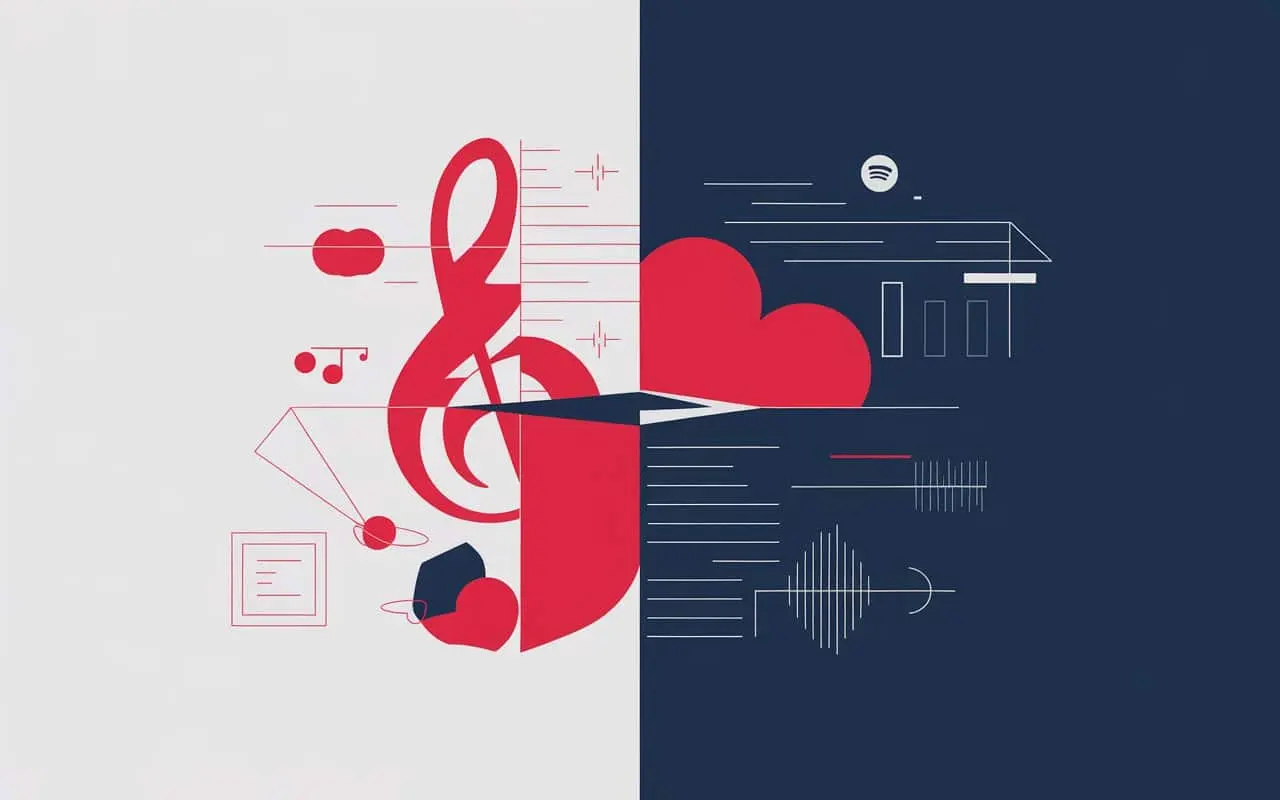
Selbstverständlich nutze ich Playlists. Viele davon habe ich allerdings selbst erstellt. Ich bin kein Freund kuratierter Playlists. Da müsste ich zu viel aussortieren.
Meine längste umfasst deutlich mehr als 1000 Songs. Sollten sich darin Titel befinden, die zur Beschreibung Liz Pellys passen? Ich frage das deshalb, weil ich die Werke und Künstler, die ich da finde, unter Lieblingssongs abgespeichert habe. Kann man überhaupt so viele Lieblingssongs haben? Macht das etwa einen Teil “des Problems” aus?
Neige ich etwa inzwischen dazu, meine Musik nicht mehr bewusst nach den “früher” üblichen Regeln auszuwählen (zu schätzen und zu lieben) und sie inzwischen einfach nur noch zu konsumieren? Ich erkenne jedenfalls das hier aufgezeigte Risiko.
Würde ich die Verfügbarkeitsvorteile, die mir ein solcher Streamingdienst bietet, gegen ein Bewusstsein eintauschen, die Lebensgrundlage von Künstlern und den profunden Wert ihrer Arbeit für mich als Individuum als auch für unsere menschliche Kultur aufgeben? Ich fürchte, ich muss diese Frage mit NEIN beantworten.
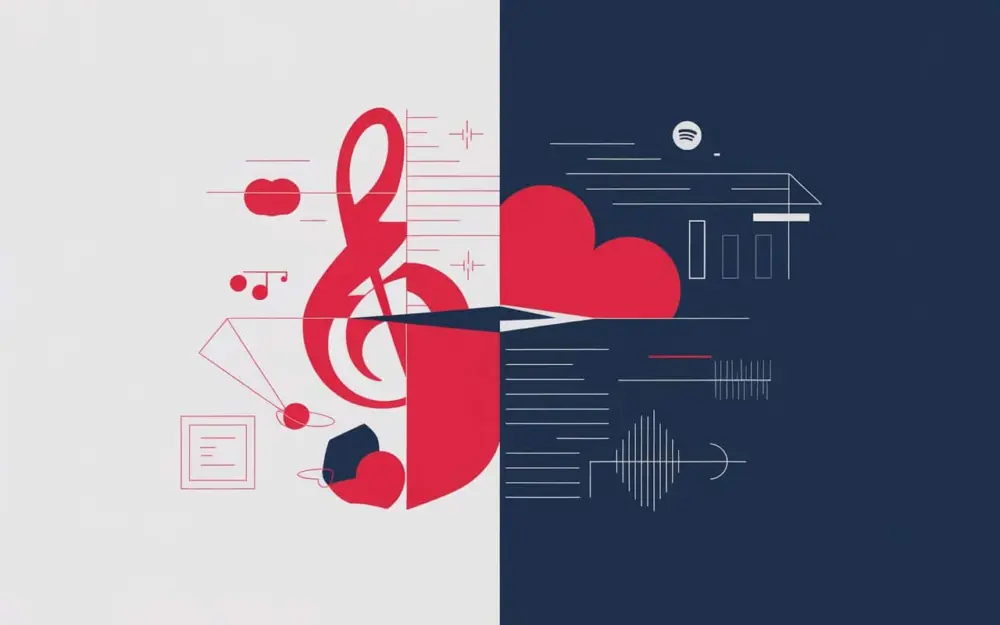

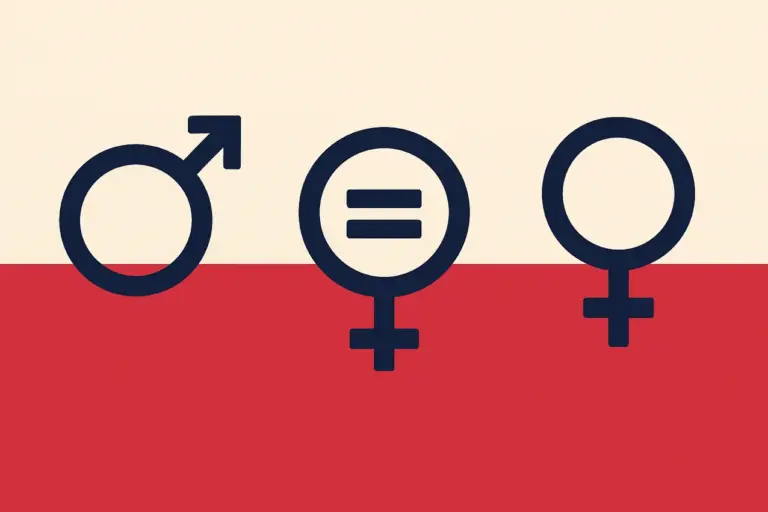
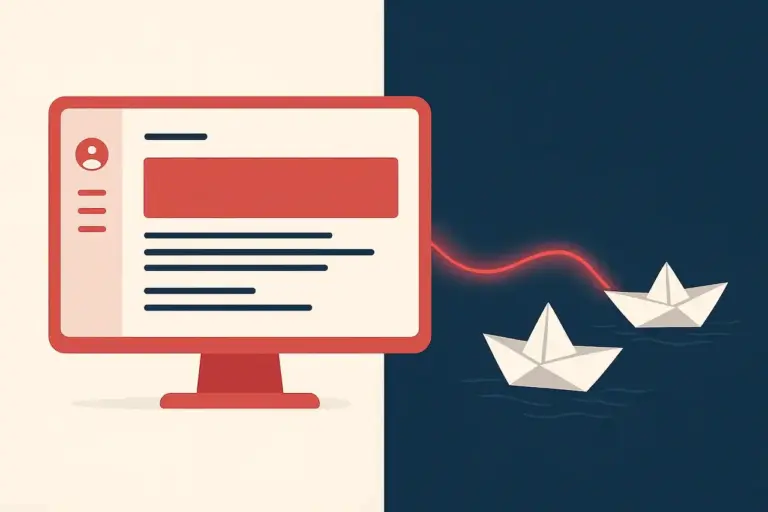





Ich habe den verlinkten Artikel neulich schon gelesen. Im Grunde beschreibt er die Konsequenz einer Entwicklung, die schon irgendwann vor ein paar Jahrzehnten begonnen hat: die umfassende Industrialisierung dessen, was einst Musik war. Die endgültige Verramschung von Kultur als x-beliebige Ware.
Es ging ja Spotify nie um Musik, den anderen Steamingdiensten ebensowenig. Wenn es möglich UND vor allem günstiger wäre, mit derselben Internettechnologie benutzte Babywindeln zur selben Zielgruppe zu “streamen”, dann würden all diese Konzerne noch heute Abend umsteigen auf die neuen “Inhalte”. Musik und Musiker spielen in diesem Geschäft überhaupt keine Rolle, sie sind bestenfalls lästiger Beifang.
Ich streame im Übrigen keine Playlisten, sonder nur Alben (oder auch mal Einzelstücke) von Musikern. Und da ich mich bei Neuentdeckungen immer sofort über die Musiker informiere, und zwar bei glaubwürdigen Quellen, weil mich deren weiteres Schaffen interessieren könnte, dürfte ich auch wenig in Gefahr sein, irgendwelchen musikindustriellen Fakes aufzusitzen und den zugehörigen wertlosen Müll zu konsumieren.
@Boris: Du hast keine Playlists? Auch keine Selbsterstellten? Ich höre mir Musik, wenn ich nicht ein einzelnes Album herauspicke, häufig aus Playlists an. Die Art von Playlists, die Pelly in ihrem Beitrag erwähnt, sind mir sicher dabei schon begegnet. Zu vermeiden ist das wohl nicht, wenn man Streamingangebote nutzt. Bei Klassik und Jazz wird es diese Missbrauch (durch Umgehung der Interpreten) vermutlich nicht so häufig geben wie in der Popmusik.
Als wertlosen Müll würde ich die heutige Musik trotz dieser Entwicklung aber nicht bezeichnen. Meine Maßstäbe sind da nicht so übertrieben hoch. Was mich in diesem Zusammenhang allerdings stört, ist, dass die Entwicklung vielleicht mit dazu führt, dass sich “die” Musik nicht nicht mehr so richtig weiterentwickelt. Aber die paar Jahrzehnte, für die ich das festzustellen glaube, sind wohl etwas wenig.
Als wertlosen Müll – im Gegensatz zu Musik – meine ich künstlich (KI) generierte … … musikähnliche Produkte. Musik, die von Menschen (Musikern) für Menschen gemacht wird, würde ich nicht wertlosen Müll nennen. Auch dann nicht, wenn sie mir überhaupt nicht gefällt.
Gerade eben einen frischen Artikel bei Heise gelesen zum — nicht nur — Spotify-Problem, dass die Algorithmen dieser Streamingdienste dafür sorgen, dass die Hörer der Playlisten immer mehr nur noch dasselbe hören, weil sich diese Listen natürlich an den Hörgeschmack anpassen. Altes bekanntes Problem. Man findet nix Neues mehr, weil man nur immer mehr vom Selben vorgesetzt bekommt.
Ich meine, ok, ich höre ja auch oft dasselbe bzw. ähnliche Musik zu der, die ich schon kenne. Aber ich wähle die Musik, die ich höre, immer manuell selbst aus und entdecke deswegen ganz bewusst neue Sachen.
Das einzige, was ich bei Amazon habe, was sowas ähnliches wie Playlisten sind, sind komplette Alben, die ich quasi als Playliste unter ihrem originalen Namen abspeichere. Als Favoriten sozusagen. Das heist dann z.B. “Jethro Tull – Living in the Past” und ist einfach das komplette Album.
Ich hätte neulich beinahe eine Playliste angelegt mit meinen persönlichen Top-Songs von Porcupine Tree und von Steven Wilson. Hab es aber doch nicht getan, und zwar aus dem Grund, dass ich dann genau in die Gefahr reinlaufe, nur noch meine Highlights zu hören und den Rest der jeweiligen Alben abseits liegen zu lassen. Was schade um die gute Musik wäre, die ich dann nicht mehr hören würde.
Was die Entwicklung der Musik angeht, glaube ich, dass sich da nicht mehr viel tut. Irgendetwas stilistisch wirklich Neues, Stilpägendes, ist mir lange nicht mehr begegnet. Wenn ich mir die verschiedenen Genres zur Auswahl bei diversen Diensten ansehe, sehe ich eigentlich nichts, was nicht mindestens zwanzig Jahre alt ist. Im Jazz scheint es allerdings ähnlich zu sein, auch da finde ich seit zahlreichen Jahren nichts genremäßig Neues mehr.
Die Zeiten, in denen es noch musikalische Aufbrüche zu neuen Ufern gab, sind mindestens seit dreißig Jahren vorbei. Irgendwann war die völlige Kommerzialisierung durch, es wurde nur noch Ware produziert und Geld verdient. Die Musikindustrie hat kreative Experimente, das Entdecken von musikalischem Neuland abgewürgt, weil es Risiko bedeutet. Und Risiko ist (zuerst immer) das Gegenteil von Umsatz. Dazu gehört Mut. Mut ist ebenfalls das Gegenteil von Umsatz.
Und dann kommen unweigerlich irgendwann keine kreativen Talente mehr nach. Weil sie keine Verträge mehr für ihr mutiges Erforschen neuer musikalischer Wege bekommen.
Das ist die Konsequenz, mit der wir heute leider leben müssen. Zum Glück gibt es einen unermesslichen Schatz guter Musik aus vielen Jahrzehnten der Vergangenheit.
@Boris:
Ich kann das für mein Musikverhalten nicht bestätigen. Oder ich habe es falsch verstanden. Ich höre manche Titel häufig und mir ist klar, wie Algorithmen wirken. Auf gleichartige Musik anhand dieser Auswahl zu treffen, hat ja auch Vorteile. Dass man hierdurch eingeengt wird im normalen Drang, auch mal etwas Neues zu hören, sehe ich nicht.
Ich will nicht bestreiten, dass ich den Komfort kuratierter Musik nicht zu schätzen wüsste. Ich mag deshalb vielleicht nicht einsehen, dass dieser Komfort einen Preis hat. Ich gehe nicht mehr an meinen Schrank, wähle eine Platte oder CD, lege sie ein und höre mir diese bewusste Auswahl an. Das kann man als Mangel verstehen. Die Auswahl einer Playlist lässt sich insofern (schon aufgrund der Menge von Titeln) nicht vergleichen. Ich brachte das Beispiel meiner Playlist (Lieblingssongs) mit über 1000 Titeln. Immer wenn ich was Neues höre und mir das Stück sehr gut gefällt, kommt es in diese Playlist. Ich lerne so, auch viele neue Stücke kennen, wie ich es sonst höchstens beim Radiohören getan hätte. Die Frage nach der Qualität stellt sich damit zunächst ja nicht, denn Musik ist auch Geschmackssache. Ein Freund hat mich immer veralbert, weil ich auf eine bestimmte Jazz-Art stehe. Die hat er schon in den 80ern als Fahrstuhlmusik abgetan. Kann man machen.
Generell stimme ich dir gefühlsmäßig trotzdem zu. Die Handhabung von Musik führt am Schluss dazu, dass wir alle verlieren werden.