Ob die aktuelle Krisenstimmung im Land ein bestimmtes Filmgenre bevorzugt? Werden eher leichte Filme, Komödien oder, wie üblich, jeder Scheiß konsumiert? Vorzugsweise also im Moment Weihnachtsfilme? Ich finde, das ist eine interessante Frage. Vielleicht kann man daran messen, wie mies die Stimmung im Land tatsächlich ist. Wie ich darauf komme?
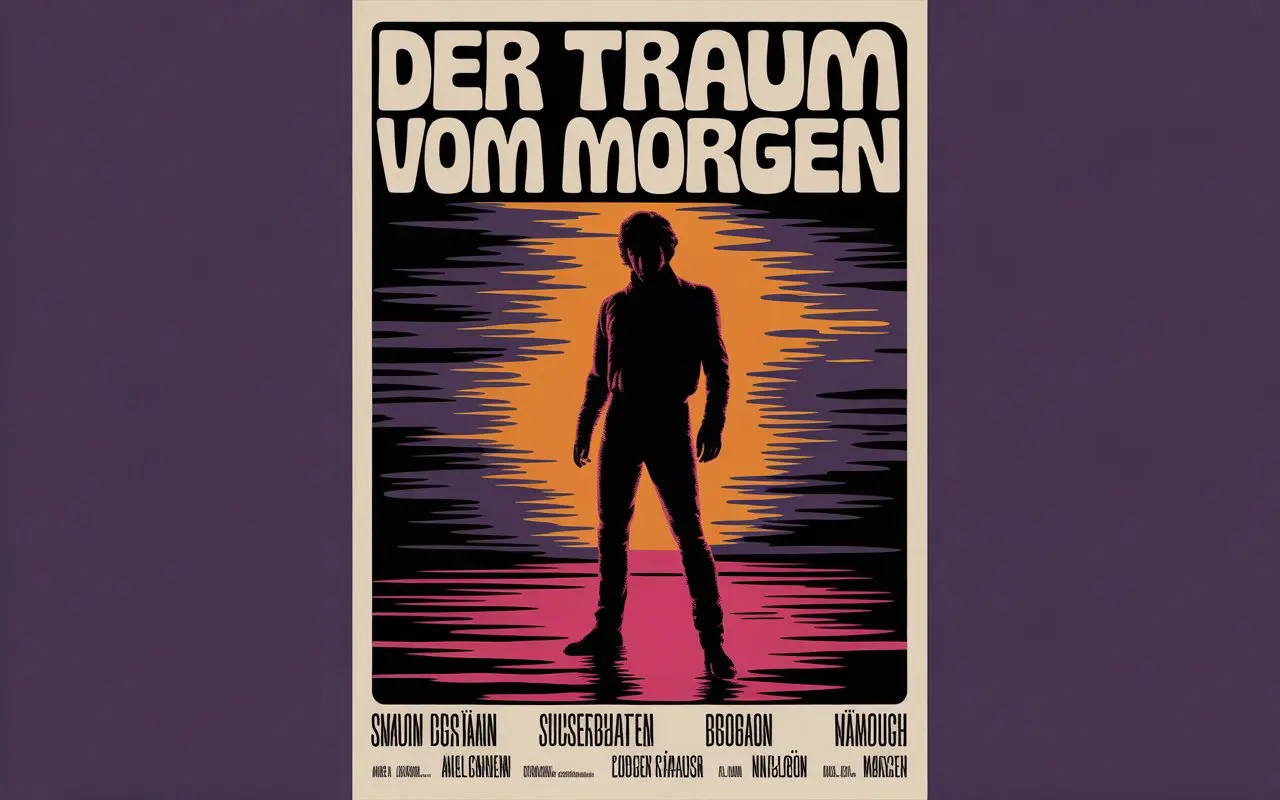
Kurz nach dem Krieg wollten alle nur noch fröhlich sein – so ungefähr lautet die Legende, die viele von uns im Kopf haben. Kino zählte zu den Lieblingsbeschäftigungen. Allerdings stolpert man auch über die gegenteilige Behauptung: Die Leute seien damals lieber in traurige, melancholische Filme gegangen. Was stimmt denn nun?
Wie so oft: Die Wirklichkeit ist komplizierter. Und genau deshalb interessant. Hat das eigentlich heute etwas mit dem Angebot der großen Streamingdienste zu tun? Warum laufen so viele Weihnachtsfilme, noch dazu in einer Qualität, die einen schon in die Verzweiflung treiben kann? Filme zum Fremdschämen. Ihr kennt das bestimmt.
Zwischen Ruinen und Rührstücken
Schaut man auf das deutsche Kino direkt nach 1945, sieht man zuerst die berühmten Trümmerfilme: zerbombte Städte, kaputte Biografien, Schuld, Scham, Orientierungslosigkeit. »Die Mörder sind unter uns« ist dafür das bekannteste Beispiel.
Das sind keine Wohlfühlfilme. Da wird nicht weggeblendet, da wird hineingeschaut in das, was man gerade hinter sich geglaubt hatte. Aber interessant: Diese Phase ist relativ kurz. Sie markiert einen moralischen und ästhetischen Einschnitt – doch das Massenpublikum, das Sonntag für Sonntag ins Kino strömt, findet seine Dauerlieblinge bald woanders.
Denn dann kommen die 50er. Es geht »aufwärts«. Wirtschaftswunder, neue Möbel, neue Autos – und im Kino: Heimatfilme, Melodramen, Musikfilme. Berge, Seen, Dirndl, Förster, Schicksalsschläge, Verwechslungen und am Ende meistens doch ein Happy End. Vielleicht lag in dieser Zeit der Grundstein für die schlimmste Phase des deutschen Nachkriegsfilms? Aber die kam erst ein, zwei Jahrzehnte später.
Wer das heute als Kitsch abtut, macht es sich zu leicht. Diese Filme waren zutiefst sentimental und – im Kern – oft melancholisch: verlorene Heimat, verlorene Liebe, verstümmelte Lebensläufe, heimliche Trauer. Nur wurde das alles in schöne Bilder und einfache Geschichten verpackt. Man ging also nicht nur ins Kino, um die Realität zu vergessen, sondern auch, um sie in eine Form zu bringen, die erträglich war.
Eskapismus mit Restschwere
Die Leute bevorzugten nach schweren Zeiten eher melancholische Stoffe. Sie wollten Leid pur, sondern gefühliges Kino mit Sicherheitsnetz. Man konnte weinen, seufzen, hoffen – aber eben in einem Rahmen, in dem am Ende meist irgendeine Form von Ordnung wiederhergestellt wurde.
Das ist ein Unterschied zu den wirklich harten Filmen der unmittelbaren Nachkriegszeit oder zu heutigen Kriegsfilmen: Damals wie heute lebt die Bereitschaft, sich mit ungeschönten Bildern eigener oder miterlebter Katastrophen zu konfrontieren. Allerdings ist auch dies nur bei einem Teil des Publikums so. Der Rest möchte eine Art seelische Massage mit Melancholie-Aroma: Wir haben viel verloren, es war schlimm. Aber schau, die Berge stehen noch, und irgendwo wartet eine Umarmung.
Interessant ist auch, wer damals vor allem im Kino saß: sehr viele Frauen, viele Geflüchtete, Alleinerziehende, Witwen, junge Leute ohne stabile Perspektive. Für sie war das Kino nicht nur Eskapismus, sondern so etwas wie ein emotionales Probierlabor: Wie könnte es sich anfühlen, wenn das Leben wieder gut wird – und darf ich mir das überhaupt wünschen?
Was das mit uns heute zu tun hat
Wenn wir heute auf Angebote von Streamingdiensten starren, in einer Welt voller Kriege, Krisen und Katastrophen, funktioniert der Mechanismus gar nicht so anders. Manche flüchten in reine Leichtigkeit: Comedy, Cosy Crime, Serie mit freundlichem Grundrauschen oder halt Weihnachtsfilme abgründigen Niveaus. Andere suchen ernstere Serien, historische Dramen, Kriegsfilme – aber auch da steckt ganz oft ein Trostversprechen drin: Es gibt Sinn, es gibt Haltung, es gibt zumindest Erklärungen.
Das Nachkriegskino gewährte in diesem Sinne keine Weltflucht und auch keine Volksuniversitäten der Schuldaufarbeitung. Es waren Orte, an denen sich Eskapismus und Melancholie die Hand gaben. Vielleicht ist das die eigentliche Pointe: Menschen in Krisen wollen selten »nur lachen« oder »nur leiden«. Sie wollen fühlen – nur bitte in Dosen, die sie aushalten. Nach dem Krieg haben das Heimatfilm und Melodram übernommen, heute machen es Serien, Streams und manchmal schon auch noch das klassische Kino.
Meine lang zurückliegende Erinnerung an eher »melancholische Filme nach dem Krieg« ist demnach nicht ganz falsch – es gab beides: Wir fliehen vor der Realität, indem wir sie auf der Leinwand so umschreiben, dass sie uns nicht unbedingt belastet, sondern uns – für zwei Stunden – das Gefühl gibt, wir könnten mit ihr leben.


Was guckt deine Ki? Oder guckt ihr auch zusammen
@Petra: Am liebsten Filme oder Dokus über die Dummheit der Menschen. Man stößt überall darauf.