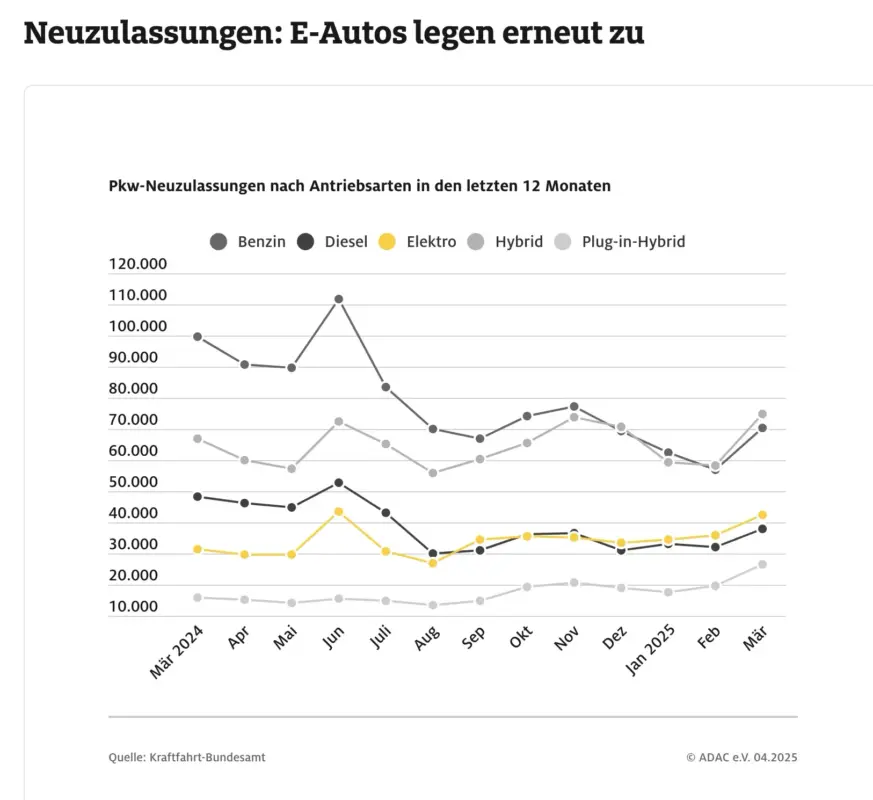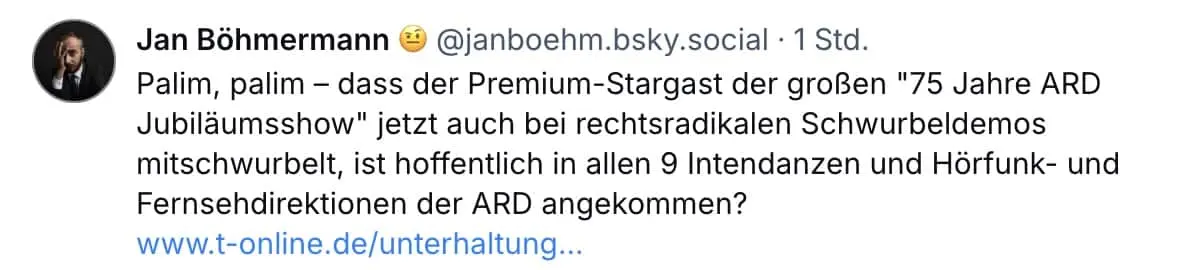Man sollte sich nicht wundern, wenn jenseits des linken Lagers Unmut darüber geäußert wird, dass zur Verteidigung unserer Demokratie staatliche Gelder an Nichtregierungsorganisationen verteilt werden, die sich mitunter wie die verlängerten Arme einer Gesinnungsgemeinschaft gebärden. Mit ruppiger Rhetorik und Missionseifer ziehen sie gegen eine Partei zu Felde, deren Existenzrecht sie zwar dulden, deren politische Repräsentanz sie jedoch mit allen Mitteln delegitimieren wollen.
Es geht, wie so oft in diesen Tagen, um die AfD. Eine Partei, die sich nicht nur selbst als „Alternative“ begreift, sondern von immer mehr Menschen in diesem Land tatsächlich als solche empfunden wird. In ihrer Radikalität, ihrer Systemverachtung und ihrer Selbstvermarktung als Sprachrohr der „wahren“ Bürger erinnert sie unübersehbar an Trumps MAGA-Bewegung. Das ist kein Zufall – es ist Ausdruck eines tiefen Misstrauens gegenüber dem politischen Betrieb, gegenüber Medien, Institutionen und letztlich gegenüber der Demokratie, wie wir sie kennen.
Doch gerade weil uns diese Demokratie so selbstverständlich erscheint, geraten wir allzu leicht ins Schwanken, wenn sie verteidigt werden muss – ausgerechnet mit Methoden, die selbst einer kritischen Überprüfung bedürfen.
Radikal, extrem – oder einfach nur unbequem?
Der feine Unterschied zwischen radikal und extremistisch ist kein semantisches Spiel. Radikale, ob von links oder rechts, wollen die Dinge ändern – mit Nachdruck, ja, aber innerhalb des Systems. Extremisten hingegen – und das ist entscheidend – möchten das System selbst zum Einsturz bringen. Die einen schlagen die Trommel der Veränderung, die anderen sägen am Fundament.
Und nun kommt unser Verfassungsschutz ins Spiel. Ein weisungsgebundener Dienst, der politische Akteure beobachten darf. In einem Land mit autoritärer Geschichte ist das gut gemeint – vielleicht sogar notwendig. Aber eben auch riskant. Denn wer garantiert, dass hier wirklich nur beobachtet und nicht beeinflusst wird? Wer traut einem politischen Apparat, wenn er sich plötzlich zum Richter über politische Konkurrenz aufschwingt?
Die Einordnung der AfD als in Teilen „gesichert rechtsextrem“ durch das BfV ist juristisch gedeckt. Doch politisch ist sie ein Pulverfass. Denn sie liefert der AfD genau das Futter, mit dem sie sich selbst inszenieren kann: als Opfer staatlicher Willkür, als Sprachrohr der Entrechteten, als letzte Bastion der Meinungsfreiheit.
Andere Länder sind zurückhaltender. In Frankreich, Großbritannien, den USA oder Skandinavien wäre eine derartige behördliche Einmischung in den parteipolitischen Wettbewerb kaum denkbar – oft sogar verfassungswidrig. Und was macht das mit uns? Vertrauen wir unserer Demokratie so wenig, dass wir sie mit Mitteln schützen, die ihren Grundsätzen zuwiderlaufen könnten?
Die Demokratie als Dienstleister – oder als Erzieher?
Es fällt schwer, angesichts der steigenden Umfragewerte der AfD nicht in Sorge oder Zorn zu verfallen. Zorn auf die, die sehenden Auges in den Abgrund blicken und dennoch ihren Protest zum Wählerwillen verklären. Und Sorge darüber, wie brüchig der demokratische Konsens mittlerweile geworden ist.
Doch zugleich muss man sich fragen: Übertreiben wir nicht auch? Ist die Angst vor dem „Vierten Reich“ gerechtfertigt oder eher ein historisches Echo, das unser Urteil trübt?
Wenn Alice Weidel versucht, dem amerikanischen Vize, Vance, deutsche Geschichte zu erklären – und dabei die Nazis ins linke Lager verortet – dann ist das nicht nur grotesk, sondern auch gefährlich. Eine Verdrehung, die symptomatisch ist für den geistigen Klimawandel, den diese Partei propagiert: Alles ist erlaubt, solange es der eigenen Weltsicht dient. Fakten sind nur noch Meinungen mit Presseausweis.
Das Problem: Solche Lügen sind effektiv. Sie verfangen. Nicht bei allen, aber bei immer mehr. Und viele zucken die Schultern – zu komplex, zu schmutzig, zu weit weg vom eigenen Alltag.
Die Normalisierung der Brandstifter
Michael Kretschmer, Jens Spahn, Philipp Amthor, Johann Wadephul (alle CDU) – sie alle sprechen sich dafür aus, den Umgang mit der AfD zu „normalisieren“. Protokollarische Gleichstellung, parlamentarische Fairness. Klingt demokratisch. Ist es vielleicht auch. Aber es ist auch ein Türöffner.
Denn wer sich darauf einlässt, übersieht womöglich, dass man sich die Regeln dieses Spiels nicht allein aussuchen kann. Eine Partei, die unsere freiheitliche Ordnung grundsätzlich infrage stellt, kann nicht auf Augenhöhe mitspielen – jedenfalls nicht, ohne dass das Spielfeld selbst beschädigt wird.
Jens Spahns Vorstoß dürfte in der Koalition für erhebliches Grummeln sorgen. Die SPD wird sich kaum als Hüterin des antifaschistischen Erbes feiern lassen wollen, während die CDU im Schatten das nächste Fenster zur Zusammenarbeit öffnet. Schon wieder Streit, schon wieder Uneinigkeit – dabei ist diese Koalition ohnehin schon auf wackligen Beinen. Und noch gar nicht wirklich in der Arbeit angekommen.
Was soll nur aus diesem Land werden?
Eine Frage, die fast verzweifelt klingt. Und doch: Sie ist berechtigt. Was soll aus einem Land werden, das sich seiner Demokratie nicht mehr sicher ist? Das auf der einen Seite wehrhaft sein will, auf der anderen Seite aber nicht weiß, wie weit diese Wehrhaftigkeit gehen darf?
Wir sollten uns daran erinnern, dass Demokratie mehr ist als ein Wahlergebnis. Sie ist ein Prozess – fragil, offen, anstrengend. Und sie braucht mündige Bürger, keine dressierten Konsumenten oder wütenden Schreihälse.
Vielleicht sollten wir nicht so viel von der AfD sprechen. Sondern mehr von denen, die ihr widerstehen. Von denen, die zweifeln, ohne zu hassen. Von denen, die sich eine bessere Politik wünschen – aber nicht um den Preis der Freiheit.
Denn am Ende ist es genau das, worum es geht: Freiheit. Und um die muss man kämpfen – immer wieder.