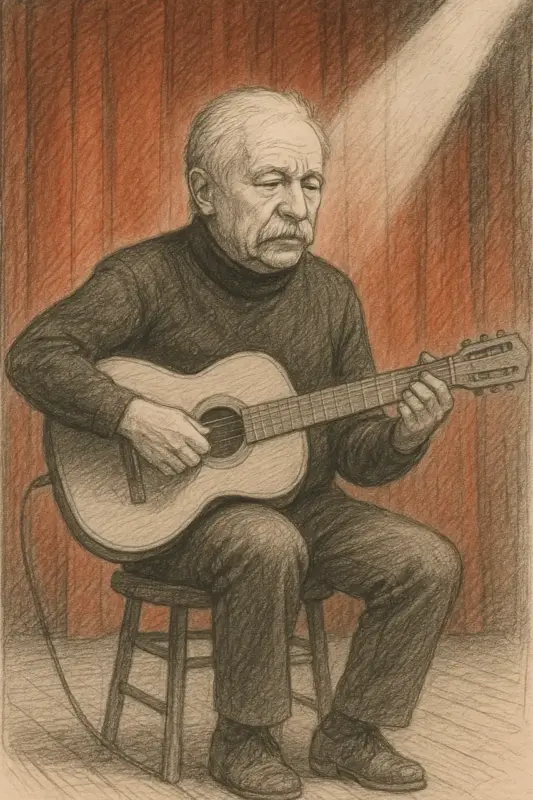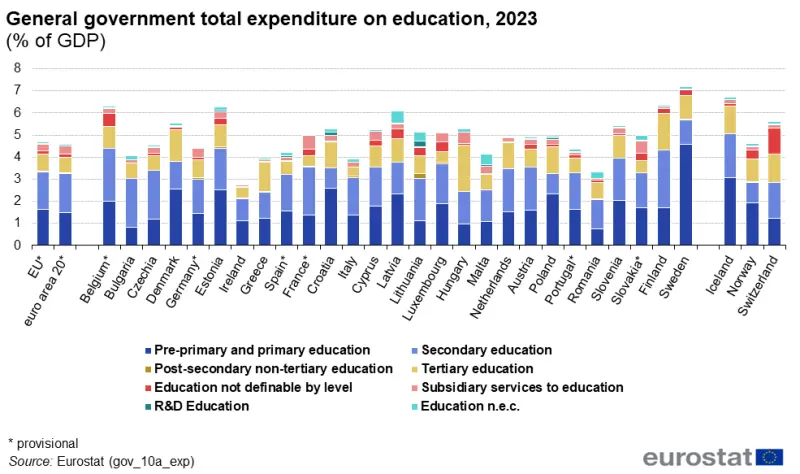Vielleicht ist es der 71-jährige (alte Sack) in mir. Vielleicht ist es aber auch nur gesunder Menschenverstand, der sich beim Lesen eines Artikels im Tagesspiegel ($) regt. Der Tenor: Höflichkeit, wie wir sie kannten, ist heute ein Ausdruck dressierter Seelenlosigkeit.
Na dann: Guten Appetit, Gesellschaft!
Ein Kind der guten Schule
Ich war ein schüchternes, braves Kind. Vielleicht sogar ein bisschen zu brav. Der Typ, der sich bei der Lehrerin entschuldigt hat, weil er einen halben Ton zu laut gehustet hat. Meine Schwester und ich wuchsen in einem liebevollen Elternhaus auf – ein Zuhause, das uns keine goldenen Löffel, aber goldene Werte mit auf den Weg gab. Allen voran: Höflichkeit.
„Bitte“, „Danke“, „Entschuldigung“ – diese Wörter waren keine Floskeln, sie waren Teil der Familien-DNA. Und ja, wir sagten sie auch dann, wenn wir nicht fühlten, was wir sagten. Wir sagten sie, weil sie dazugehören. Weil sie zeigen: Ich bin nicht allein auf der Welt. Es gibt andere, und die verdienen Respekt.
Floskel oder Fundament?
Heute sagen moderne Erziehungsratgeber: Wenn ein Kind nicht intrinsisch motiviert ist, soll es sich bitte nicht bedanken. Aha.
Was bitte ist das für eine Haltung? Soll der Nachwuchs demnächst auch nur noch dann grüßen, wenn er vorher ein Sinnfindungsseminar absolviert hat? Oder den Müll rausbringen, wenn er sich innerlich wirklich bereit dazu fühlt?
Nein, wirklich. Ich verstehe ja, dass Kinder heute selbstbewusster erzogen werden sollen. Aber Selbstbewusstsein ohne Rücksichtnahme ist einfach nur Ego mit WLAN.
Die Sache mit der Birne (und dem Holzscheit)
Ich erinnere mich noch genau an eine Szene aus meiner Kindheit. Mein bester Freund und ich hatten eine kleine… nennen wir’s „Uneinigkeit“. Es ging um eine Birne. Eine große, saftige, vom Baum gepflückte Birne. Ich hatte sie. Er wollte sie. Was folgte, war ein beherzter Schlag mit einem Holzscheit auf meinen Kopf.
Mein Vater nahm das nicht ganz so locker. Er zerrte mich samt Beule und Moralanspruch zum Vater meines Freundes. Er forderte eine Entschuldigung. Die Antwort meines Freundes? „Das muss ich mir aber noch mal überlegen.“
Und doch: Wir blieben Freunde. Vielleicht, weil es damals noch normal war, dass eine Entschuldigung nicht immer spontan, aber eben notwendig war. Und weil niemand auf die Idee gekommen wäre zu sagen: „Wenn du’s nicht fühlst, sag’s halt nicht.“
Die neue Unverbindlichkeit
Heute erleben wir es häufig: Kinder, die bei Geschenken nicht mal den Anstand haben, einen Blick über das Geschenkpapier hinaus zu riskieren. Das Präsent wird kommentarlos in die Ecke gelegt, zwischen das kaputte ferngesteuerte Auto und den Amazon-Karton von letzter Woche.
Ach ja, die gute alte Erklärung: “Die Eltern haben sich halt keine Mühe gegeben.” Stimmt. Das Geschenk kam ja nicht aus handgeschöpftem Filzpapier, sondern vom Wunschzettel. Und der kam von Amazon. Also: selbst schuld, liebe Großeltern.
Aber der eigentliche Skandal liegt nicht im Geschenk – sondern in der Grundhaltung. In einer Erziehung, die jegliches höfliche Verhalten nur gelten lässt, wenn es vermeintlich „echt“ ist. Wo sind wir denn da hingekommen?
Eltern, Experten und enthemmte Empathie
Die Erziehungsexperten unserer Zeit haben viele kluge Bücher geschrieben, aber offenbar wenige Holzscheite abbekommen. Sie sagen: „Erzwungene Höflichkeit ist keine.“
Ich sage: Erzwungene Höflichkeit ist besser als gar keine. Und vielleicht wird aus dem „Danke“, das zuerst nur eine soziale Pflicht war, irgendwann ein echtes. Weil man erlebt, dass Höflichkeit Türen öffnet, Herzen wärmt – und Beziehungen rettet.
Wir sind nicht nur Kopf und Bauch. Wir sind auch Gewohnheitstiere. Und wenn wir unseren Kindern beibringen, dass man andere grüßt, sich bedankt und sich auch mal ohne tieferliegende Sinnkrise entschuldigt, dann formen wir Menschen, die in einer Gemeinschaft bestehen können.
Fazit? Bitte. Danke. Gern geschehen.
Ich bleibe dabei: Manchmal ist eine Floskel doch besser als “moderne Erziehungsmethoden”. Und bevor wir die letzten Reste höflicher Umgangsformen auf dem Altar der Authentizität opfern, sollten wir uns vielleicht mal wieder gegenseitig daran erinnern, wie gut ein „Danke“ tut.
Und falls das jemandem zu oldschool ist – dem werfe ich keine Birne an den Kopf. Aber vielleicht einen Blick. Einen, der sagt: Ich wünsche mir ein bisschen mehr gegenseitigen Anstand. Nicht, weil ich’s fühle – sondern weil ich’s wichtig finde.