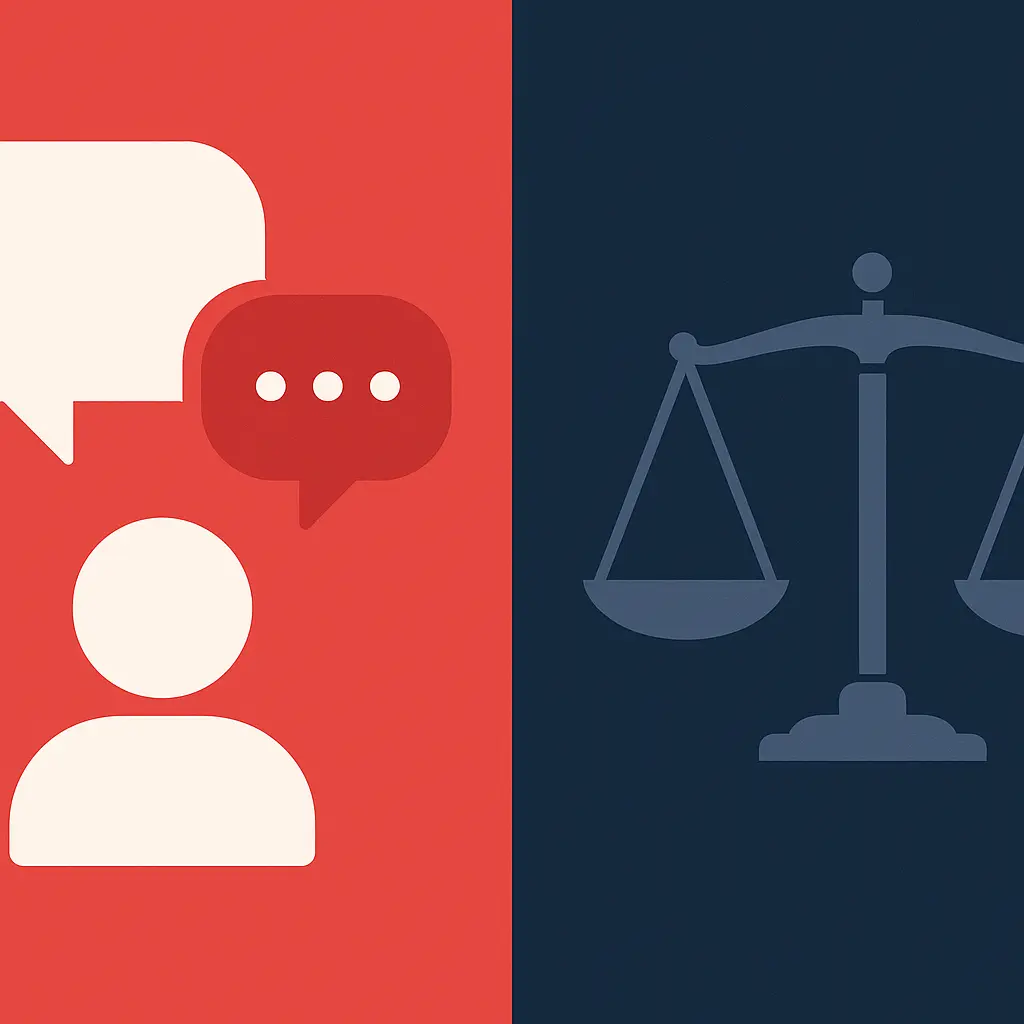
Inhalt
Immer wieder wird in politischen Diskussionen auf die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes zum Existenzminimum verwiesen. So auch gestern bei Markus Lanz, wo der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, dieses Argument in die Debatte einbrachte. Natürlich gilt: Urteile des höchsten deutschen Gerichts sind zu respektieren. Doch Respekt bedeutet nicht, dass man sie nicht hinterfragen dürfte. Manche Entscheidungen stammen aus einer Zeit, die unmittelbar von den Erfahrungen der Nachkriegs- und Nachkriegsjustiz geprägt war. Es ist daher legitim zu prüfen, ob die damaligen Maßstäbe noch zur heutigen gesellschaftlichen Realität passen.
Spielräume für Reformen nutzen
Was mich an der immer gleichen Argumentation aus dem »linksgrünen« Spektrum stört, ist die Tendenz, das Bundesverfassungsgericht wie ein unantastbares Schutzschild gegen nötige Reformen (Migration/Versorgung) zu verwenden. Dabei hat der Gesetzgeber durchaus Spielräume, um das Sozialrecht anzupassen – insbesondere, wenn es darum geht, Missbrauch zu verhindern und den Sozialstaat zukunftsfest zu machen. Dass es Missbrauch gibt, wird von manchen politischen Kräften gerne kleingeredet, obwohl viele Bürgerinnen und Bürger genau damit ihre Alltagserfahrungen machen. Eine ehrliche Debatte müsste anerkennen, dass Schutz vor Armut und die Verantwortung des Einzelnen keine Gegensätze sind. Das gilt sogar für Grundrechte, die in einem völlig anderen zeitlichen Zusammenhang entstanden und damals gut zu begründen waren. Sie heute gleichermaßen als Schutzschild vor nötigen Veränderungen zu nutzen, ist aus meiner Sicht nicht in Ordnung.
Um dem Einwand zuvorzukommen, Gesetze könnten nicht je nach Tagesform oder Kassenlage verändert werden, lohnt ein Blick in die Geschichte. Willy Brandt (Herbert Frahm) etwa fand im Exil keinen Schutz, weil Norwegen damals ein besonders großzügiges Einwanderungsrecht besaß. Er war vielmehr auf die persönliche Hilfe einzelner angewiesen und ging bei seiner Flucht große Risiken ein. Gerade dieses Beispiel zeigt: Rechtslagen sind immer Ausdruck ihrer Zeit – und sie können, ja müssen, sich verändern. Deshalb ist es unredlich, heutige Urteile oder Gesetze als unantastbar darzustellen, als wären sie überzeitliche Naturgesetze. Herr van Aken argumentierte meiner Ansicht nach bei Markus Lanz also ganz falsch.
Mehr Ehrlichkeit in der politischen Debatte
In Talkshows wie »Markus Lanz« wirkt es mitunter so, als würden einige Politiker eher Schlagworte bedienen, um ihre eigene Klientel zu mobilisieren, statt die komplexen Probleme offen zu diskutieren. Das ist schade, weil es die ohnehin aufgeheizte Debatte um Themen wie das Bürgergeld oder soziale Gerechtigkeit noch weiter polarisiert. Was wir brauchen, ist keine Rhetorik der einfachen Wahrheiten, sondern eine nüchterne Auseinandersetzung: Wo ist das Existenzminimum tatsächlich nicht gesichert? Wo gibt es Fehlanreize? Und wie können wir Solidarität und Eigenverantwortung sinnvoll austarieren?
Das europäische Asylsystem gleicht einer Lotterie um Leben und Tod, um Freiheit und Unterdrückung.
Ruud Koopmans
Höchst interessant fand ich die Informationen, die Ruud Koopmans, Migrationsforscher, zur Sendung beitrug. Vor allem, weil ein Schlaglicht auf angebliche Studien fiel, mit deren Ergebnissen bestimmte Kreise in diesen Diskussionen operieren. Zu der Tatsache, dass über die Hälfte aller Bürgergeld-Empfänger migrantischer Herkunft sind, wies Koopmans u. a. darauf hin, dass diese Realität ein großes Problem sei, an dem man zudem erkennen könne, dass die Migrationspolitik unseres Landes von Dysfunktionalität und mangelnder Bereitschaft geprägt sei, die Dinge im Sinne der Bevölkerung zu ordnen. Das haben in meinen Augen die merkwürdigen Statements von Herrn van Aken bestätigt.
Nur wenn wir uns diesen Fragen stellen, anstatt uns hinter Gerichtsurteilen oder politischen Schlagworten zu verschanzen, kommen wir zu tragfähigen Lösungen, die unserer Gesellschaft wirklich gerecht werden.
Die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes zum Existenzminimum verdienen Respekt – dürfen aber nicht als Dogma jede Reform blockieren. Politische Debatten sollten Missbrauchsrisiken anerkennen und ehrlicher geführt werden, statt sich in Schlagworten zu erschöpfen.




Was wir brauchen, sind Hacker, die Cum Ex und Cum Cum wieder zurückbuchen. Dann klappt’s sogar wieder mit dem Bürgergeld, der Schulsanierung und der Restauration der Infrastruktur.
@Juri Nello: Ja, das würde mir auch gefallen. Aber in diese Idee wird wohl kein Hirn gesteckt. Es wäre ja auch nicht legal. Aber darauf achten manche nur in solchen und vergleichbaren Fällen.
Die Ausführungen des BVerfG basieren NICHT auf den »Erfahrungen der Nachkriegs- und Nachkriegsjustiz«, sondern sind viel neuer.
Perplexity: »Die verfassungsrechtliche Definition des Existenzminimums stammt zentral aus dem BVerfG-Urteil vom 9. Februar 2010 (Az.: 1 BvL 1/09 u.a.), wobei Vorentscheidungen ab den 1990er Jahren die steuerrechtliche und sozialrechtliche Herleitung begründet haben.«
Bundestag.de dazu:
Ich bin froh, dass das BVerfG hier Blöcke eingeschlagen hat, an denen keine Rotstiftpolitik vorbei kommt. Das heißt nicht, dass man Missbrauch nicht bekämpfen könnte oder sollte, der teils »bandenmäßig« von Immigranten aus östlichen Ländern mit einiger krimineller Energie perfektioniert wurde.
Auch hat das BVerfG keineswegs eine konkrete Höhe der Leistungen verordnet, sondern lediglich zur Errechnungsweise (inkl. Anpassung) entschieden. Es muss sich allerdings um Summen handeln, die die o.g. Bedarfe erfüllen.
Mich ärgert diese Verengung der Spardebatte aufs Bürgergeld. Es gibt tausende Förderprobgramme und Subventionen durch Bund und Ländern, die in diesem Kontext nie thematisiert werden. Die Frage nach dem Umfang der Subventionen beantwortet Googles KI so:
»Der deutsche Staat hat im Jahr 2024 laut dem 29. Subventionsbericht der Bundesregierung rund 67 Milliarden Euro für Finanzhilfen und Steuervergünstigungen eingeplant. Berücksichtigt man die Finanzhilfen des Bundes, der Länder und der Kommunen, belief sich das gesamte Subventionsvolumen im Jahr 2024 auf 285 Milliarden Euro an Finanzhilfen und Steuererleichterungen, so eine Studie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Diese Zahlen spiegeln einen deutlichen Anstieg der Subventionen wider. «
Der Vollständigkeit halber was zu 2025:
»Der deutsche Staat plant für 2025 einen Anstieg der Subventionen auf etwa 78 Milliarden Euro, was einen Rekordwert darstellt. Dieser Anstieg ist vor allem auf die Übernahme der Kosten für die EEG-Umlage durch den Bund zurückzuführen, die seit 2024 im Haushalt des Bundes enthalten sind. «
Ich kritisiere das nicht in diesem Detail, stecke nicht drin in der Debatte, wieviel denn die EEG-Umlage für einzelne Haushalte bedeuten würde.
Nur insgesamt wundert mich, dass es »ganz normal« ist, dass Landwirte 50% ihres Einkommens aus Förderungen genierieren und auch Dax-Konzerne ordentlich subventioniert werden. Sicher alles mit nachvollziehbaren Gründen, aber doch immer außerhalb von Spardebatten.
@ClaudiaBerlin: Ein grundlegendes Missverständnis. Ich habe schlecht bzw. unverständlich argumentiert. Sorry dafür.
Gemeint war mit meinem Hinweis auf frühere Erfahrungen nicht die Festlegung eines Existenzminimums. Dass diese von mir nicht gemeint sein können, habe ich mal als selbstverständlich vorausgesetzt.
Die Lehren, die wir aus der Nazi-Zeit im Hinblick auf die Behandlung von Asylgesuchen, den generellen Umgang mit gefährdeten Menschen zogen, wurden vor einem völlig anderen Hintergrund festgelegt. Das Nazi-Regime und eine Republik, die in ihren demokratischen Strukturen noch keineswegs gefestigt war, hat uns diese wichtigen und richtigen Lehren ziehen lassen.
Heute sind die Voraussetzungen anders und wir dürfen uns durchaus zumuten, über die Regelungen nachzudenken, die bis in die späten 80er hinein, sinnvoll und gerecht wirken konnten. Viele der jetzt bei (mit?) uns lebenden Asylbewerber erfahren nur zu einem vermutlich eher sehr geringen Anteil die Art von Not, die als Grundlage der ursprünglichen Asylgesetzgebung diente. Das meinte ich mit meinem argumentativen, aber schlecht ausformulierten Ansatz.
Ich bleibe aber bei meiner Kritik an der linken »Doktrin«, dass all das, was grundgesetzlich geregelt ist und durch Urteile des BVerfG immer wieder bestätigt wurde, gleichsam sakrosankt sein soll. Das geht mir auf den Keks. Die Dinge haben sich verändert und wenn man will, kann man aufgrund neuer Erkenntnisse sogar das Grundgesetz ändern. Das muss nur in überzeugender und haltbarer Form passieren. Aber das passt Linken und Grünen überhaupt nicht in den Kram, weshalb immer wieder auf diese Schablonen zurückgegriffen wird.
Es wird immer so bleiben, dass Bürger die Sichtweise der jeweiligen Regierungen nicht teilen. Die ist aber verantwortlich dafür, dass die Dinge weitergehen und das Land funktioniert. Ich halte es für interessant, wenn auch du davon ausgehst, dass »Rotstiftaktionen« an einmal festgelegten Normen aufgrund von höchstrichterlichen Entscheidungen nichts mehr verändern können sollen. Nun, ich hoffe, dass die finanziellen Spielräume künftig nicht so beschaffen sein werden, wie ich derzeit annehme.
Geld kann man immer in verschiedene Projekte stecken. Das gilt auch für Staatshaushalte. Wenn also jetzt so viel Kohle ins Militär, in Aufrüstung, investiert wird, wird es neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen wir stecken, auch darüber noch heftigste Diskussionen geben. Wir haben wahrlich genügend Baustellen, für die das Geld fehlt. Und das wird sich aus meiner Sicht noch sehr verschärfen.
Die Kiste mit den Subventionen wird nicht geleert, weil die Folgen eines Abbaus von Subventionen nicht einmal annähernd sauber beschrieben werden. Es bliebe natürlich nicht ohne Auswirkung, wenn man diese Töpfe einfach leeren und dem großen Topf sozusagen zuschlagen würde. Großenteils beruhen Subventionen auf Vereinbarungen, die strukturelle Veränderungen im Land mildern sollten. Das wären dann milde Gaben auf Zeit gewesen. Aber man weiß ja wie das läuft. Gibst du einmal an eine Lobbygruppe Subventionen des Staates, wirst du diese gewöhnlich nicht mehr los. Interessant, wie wenig das thematisiert wird.
@Horst Schulte: Meine Rede! Und ich verweise nochmal drauf, dass das BVerfG keine Summen festgelegt, sondern nur eine Berechnungsweise upgedatet hat.
Im übrigen teile ich deine Sorgen! Seit Antritt der neuen Regierung habe ich bezüglich ihrer Gesetze und VOs NUR von AusgabenSTEIGERUNGEN gehört – und jedes Mal denke ich mir: Wolltet Ihr nicht sparen?
Was die Unzufriedenheit der Leute angeht: Ich denke, die könnte man mit dem entsprechenden politischen Willen durchaus mindern! Wenn nämlich gezeigt würde, dass ALLEN was abgenommen/eingespart werden würde – auch was die Gehälter und Pensionen der Politiker angeht, die überaus großzügigen Pensionen der Beamten und vieles mehr. Auch bescheidenere Ausstattungen (Bauten, Büros, KFZs) wären ein schönes Zeichen, dass ALLE »ihren Gürtel enger schnallen«. Aber sowas ist ja schier unvorstellbar…
@ClaudiaBerlin: Genau das finde ich auch. Es braucht Maßnahmen, die als gerecht empfunden werden. Das kann doch nicht so schwer sein. Man könnte das tun. Z.B. wäre die Erweiterung des Kanzleramtes eine Maßnahme, die man vielleicht noch absagen könnte. Aber irgendwas hindert die Regierung daran, das zu tun.