Ein Ministerialrat, der sich über die einseitige Berichterstattung des dänischen Rundfunks beklagt. Eine deutsche Urlauberin, die ihre Begeisterung für den „Führer“ nicht hinter dem Berg hält. Und Hotelgäste, die lieber über das Wetter plaudern als über die politische Lage. Willkommen im Seebadhotel – einem Mikrokosmos der Apathie.
Die dänische Serie Badehotellet (dt. Seebadhotel) spielt in den Sommermonaten der Jahre 1928 bis 1947 an der Nordseeküste. Europa taumelt auf die Katastrophe zu, aber in den komfortablen Suiten des Badehotels scheint die Welt in Ordnung. Die Serie ist nicht laut, nicht dramatisch. Und genau deshalb trifft sie einen Nerv: Sie zeigt, wie die Normalität des Alltags politische Entwicklungen stillschweigend begleitet, mit einem Lächeln und einem Gin Tonic in der Hand.
Nur der Ministerialrat wirft gelegentlich einen Blick auf die Welt außerhalb der Küste. Er kritisiert die mangelnde Objektivität der Rundfunk-Berichterstattung. Das klingt vertraut. Damals wie heute ist die Frage: Wer kontrolliert die Wahrheit? Die anderen Hotelgäste ziehen es vor, sich damit nicht zu beschäftigen. Politik stört die Ferienlaune.
Diese Gleichgültigkeit, dieses „Lieber nicht darüber reden“ oder „wir können es ohnehin nicht ändern“, zieht sich durch die Serie wie der Horizont am Meer. Und sie erinnert schmerzhaft daran, wie leicht wir bereit sind, den Blick abzuwenden, wenn die Dinge unangenehm werden.
Zwischen Glanz und Abgrund: Weitere Serien der Zwischenkriegszeit
Badehotellet ist nicht allein. Zahlreiche Serien der letzten Jahre haben die Zwischenkriegszeit als erzählerisches Labor entdeckt – und sie alle werfen Fragen auf, die uns auch heute betreffen.
Berlin, 1929: Im legendären Tanzlokal Moka Efti drängen sich Nachtschwärmer zu Jazzklängen, während draußen Arbeitslose und Kriegsveteranen auf den Straßen ums Überleben kämpfen. Solche kontrastreichen Bilder zeichnen die TV-Serie Babylon Berlin (Deutschland, seit 2017), die den Zeitgeist der späten Weimarer Republik einfängt. Berlin wird darin als „Metropole in Aufruhr“ gezeigt – eine zerrissene Stadt im radikalen Wandel. Tatsächlich standen in der Hauptstadt der 1920er-Rausch und Elend nebeneinander: rauschhafter Exzess und extreme Armut, Emanzipation und Extremismus prallen aufeinander. Die „Goldenen Zwanziger“ brachten künstlerische Blüte und nächtliches Vergnügen, ließen aber auch Kriminalität blühen und politische Spannungen eskalieren. Babylon Berlin lässt uns in diese schillernde und zugleich brüchige Welt eintauchen – eine Welt, die ahnen lässt, wie die Gesellschaft am Abgrund balanciert, kurz bevor der Nationalsozialismus alles in die Katastrophe stürzt.
Auch international widmen sich erfolgreiche Serien jener Zwischenkriegszeit als Spiegel der Gesellschaft. Peaky Blinders (Großbritannien, 2013 – 2022) etwa versetzt uns nach Birmingham 1919, in eine vom Krieg gezeichnete Industriestadt. Eine ehemalige Gang von Kriegsveteranen um Tommy Shelby kämpft sich durch das Milieu aus Armut, Erwerbslosigkeit und organisiertem Verbrechen – und sieht sich bald neuen Bedrohungen gegenüber. Spätestens in den späten Staffeln tritt mit Sir Oswald Mosley ein berüchtigter Faschist auf den Plan, der im Großbritannien der 1930er die rechtsextreme British Union of Fascists anführt. Die Serie zeigt so nicht nur das Elend und die Wut der Arbeiterklasse nach dem Ersten Weltkrieg, sondern auch das Aufkommen radikaler Ideologien im Untergrund der Gesellschaft.
Einen ganz anderen Blickwinkel bietet Downton Abbey (Großbritannien, 2010 – 2015): Hier stehen ein aristokratisches Landgut in Yorkshire und sein Personal im Mittelpunkt. Zwischen 1912 und 1926 erlebt die Adelsfamilie Crawley eine Folge tiefgreifender Umbrüche. Der Untergang der Titanic markiert den Auftakt, gefolgt vom Ausbruch des Ersten Weltkriegs, der Spanischen Grippe, der Einführung des Frauenwahlrechts und dem irischen Unabhängigkeitskrieg.
Downton Abbey zeigt diesen Wandel mit prachtvollen Kulissen – und dennoch mit realistischer Detailtreue. Alte Hierarchien beginnen zu bröckeln. Diener verlassen traditionelle Lebenswege. Und Frauen erobern sich nach und nach neue Rollen in einer sich verändernden Gesellschaft.
Eine weitere Facette liefert Las chicas del cable – Die Telefonistinnen (Spanien, 2017 – 2020). Diese spanische Netflix-Serie folgt vier jungen Telefonistinnen im Madrid des Jahres 1928, die alle aus unterschiedlichen sozialen Schichten stammen. Vor dem Hintergrund der technischen Moderne – dem Aufkommen der Fernsprech-Technologie – kämpfen Lidia, Carlota, Ángeles und Marga um persönliche Freiheit und Gleichberechtigung in einer männlich dominierten Gesellschaft.
Zugleich werden sie Zeuginnen der politischen Entwicklung Spaniens jener Jahre. Die Serie beginnt in den späten 20ern und führt durch die turbulente Zweite Spanische Republik bis an den Vorabend des spanischen Bürgerkriegs 1936. Damit zeigt Die Telefonistinnen eindrücklich, wie eng private Schicksale und gesellschaftliche Umbrüche verflochten sind: Während die Protagonistinnen um Selbstbestimmung ringen, verdunkeln sich nach und nach die politischen Wolken – eine Parallele, die viele europäische Länder der Zwischenkriegszeit teilen.
Diese und andere historische Serien dienen also nicht nur der Unterhaltung, sondern als Fenster in die Vergangenheit. Sie machen spürbar, wie die Menschen in den Jahren zwischen den Weltkriegen lebten, liebten und litten. Vor allem zeigen sie, wie instabil die Verhältnisse nach dem Schock des Ersten Weltkriegs waren: Demokratien waren neu und fragil, alte Monarchien verschwunden, die Wirtschaft mal hyperaktiv (Spekulationsblase, „Roaring Twenties“), mal am Boden (Weltwirtschaftskrise). Arbeitslosigkeit und Armut standen glitzerndem Großstadtleben gegenüber.
Zugleich radikalisierten sich Ränder von links und rechts; viele fühlten, die etablierte Politik habe versagt. Serien wie diese sind ein Spiegel: Sie fangen die Atmosphäre jener Zeit ein – das Flirren zwischen Aufbruch und Absturz – und machen die Gefühlslage greifbar, die damals viele umtrieb.
Nationalistische Tendenzen in Europa heute
Fast ein Jahrhundert später blickt Europa erneut in einen Abgrund wachsender politischer Extreme. Was einst Geschichte schien, wirkt plötzlich beklemmend aktuell: In mehreren europäischen Ländern haben nationalistische oder rechtspopulistische Parteien heute Regierungsverantwortung übernommen – oder stehen kurz davor.
In gleich sechs EU-Staaten – darunter Italien, Finnland, die Slowakei, Ungarn, Kroatien und Tschechien – sitzen inzwischen rechtspopulistische oder nationalkonservative Parteien mit am Regierungstisch.
In Schweden etwa mischt die Partei Sverigedemokraterna kräftig mit: Sie stellt zwar keine Minister, gibt aber als Tolerierungspartner den Ton an – der Einfluss ist spürbar, auch ohne Kabinettsposten.
Finnland wird seit 2023 von einer Koalition regiert, an der die Finnische Partei beteiligt ist – früher bekannt als „Wahre Finnen“. Ihre Linie ist klar: strikter Kurs bei Migration, kritische Haltung gegenüber der EU.
Und in Italien steht seit den Neuwahlen 2022 erstmals eine postfaschistische Partei an der Spitze des Staates. Giorgia Meloni und ihre Fratelli d’Italia stellen die Ministerpräsidentin – und prägen die Regierung mit nationalistischem Ton und konservativer Weltanschauung. Ihre Regierung aus nationalistischen und rechtskonservativen Kräften hat u.a. eine harte Linie in Migrationsfragen und ein betont traditionalistisches Gesellschaftsbild in ihr Programm geschrieben.
Auch in Osteuropa schlagen rechte Töne an. In Ungarn regiert Viktor Orbán bereits seit 2010; seine Fidesz-Partei hat ein System „illiberaler Demokratie“ geschaffen, das unabhängige Medien und Gerichte gezielt schwächt und mit nationalistischer Rhetorik die eigene Macht zementiert.
In Polen lenkte die nationalkonservative PiS (Prawo i Sprawiedliwość, Law and Justice) acht Jahre lang (2015 – 2023) die Regierung und baute in dieser Zeit Justiz und öffentlich-rechtliche Medien nach ihrem Gusto um – ein Kurs, der das Land mehrfach in Konflikt mit der EU brachte. (Erst Ende 2023 wurde PiS durch ein pro-europäisches Oppositionsbündnis abgewählt, was viele als Votum gegen den autoritären Kurs werteten.)
Am 1. Juni 2025 gewann Karol Nawrocki, unterstützt von der nationalkonservativen PiS-Partei, knapp die Präsidentschaftswahl in Polen mit 50,89 % der Stimmen. Sein Sieg könnte die pro-europäischen Reformen der Regierung unter Premierminister Donald Tusk erheblich behindern, da der Präsident in Polen über weitreichende Befugnisse verfügt, einschließlich eines Vetorechts. Nawrockis EU-skeptische Haltung und seine Nähe zu anderen nationalistischen Führern in Europa lassen befürchten, dass Polen sich weiter von der EU entfernt und demokratische Institutionen geschwächt werden könnten.
Auch Slowenien und Serbien standen zeitweise unter dem Einfluss populistischer Führungspersonen, die mit markigen Parolen und autoritärem Gestus auf Stimmenfang gingen. In der Slowakei kehrte 2023 der umstrittene Ex-Premier Robert Fico zurück an die Macht – gemeinsam mit der rechtsextremen SNS, die im Wahlkampf mit ultranationalistischen Tönen auf sich aufmerksam machte.
Doch selbst vermeintlich stabile Demokratien sind nicht immun. In den Niederlanden etwa landete der islamfeindliche Provokateur Geert Wilders mit seiner PVV Ende 2023 einen Wahlsieg. Im Frühjahr 2024 wurde daraus ein handfestes Regierungsbündnis – und vermutlich die rechteste Regierung, die das Land seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat.
Gleichzeitig wachsen klassische Rechtsparteien europaweit: Sie gewinnen Wähler, rücken in die Parlamente vor – und drängen die politische Mitte zunehmend an den Rand. In Frankreich erreicht Marine Le Pens Rassemblement National in Umfragen bereits über 30 % und liegt damit klar vor Emmanuel Macrons zentristischer Partei. Und in Deutschland schließlich erstarkt die AfD: Sie liegt mit rund 20 % zeitweise gleichauf mit den Volksparteien. In einigen ostdeutschen Bundesländern wurde sie zuletzt sogar stärkste Kraft. Erstmals seit 1945 gewann mit der AfD ein rechter Außenseiter einen Landratsposten, und die Partei zieht – wenngleich bislang isoliert – in immer mehr Landtage ein. Die Alarmglocken läuten also längst.
Echo der Geschichte? Diese aktuellen Entwicklungen lassen unweigerlich Parallelen zur Zwischenkriegszeit erkennen. Natürlich wiederholt sich Geschichte nie eins zu eins, doch gewisse Muster ähneln sich auf frappierende Weise. So befinden sich auch heute viele Bürger in einem Gefühl der Unsicherheit: Krisen und Umbrüche erschüttern die Gesellschaft, von Finanzkrisen über Pandemien bis hin zu rasanten technologischen Veränderungen. Inflation und Energieengpässe nagen in manchen Ländern am Wohlstand, globale Migration und Kulturwandel verunsichern Teile der Bevölkerung. Vor 100 Jahren litten die Menschen unter ganz ähnlichen Problemen – der Vergleich mit der Weimarer Zeit drängt sich auf.
Damals hatten Krieg, Hyperinflation und Arbeitslosigkeit breite Schichten in Verzweiflung gestürzt. Gesellschaften „buckelten unter Stress“: Erst Weltkrieg, dann eine tödliche Pandemie, dann galoppierende Teuerung – extreme wirtschaftliche Not und soziale Ängste schürten Wut auf das Establishment . Populisten fanden darin ihren Nährboden. Wie in den 1920ern ein Mussolini oder Hitler versprechen heutige Rechtsaußen-Politiker einfache Lösungen und nationale Wiederauferstehung.
Sie verstehen es meisterhaft, auf den Klaviaturen von Angst und Demütigung zu spielen. Sie geben dem Zorn der Menschen Raum – nicht, um ihn zu lindern, sondern um ihn zu lenken. Die Schuld wird Sündenböcken zugeschoben, die Ursachen vereinfacht, und sich selbst inszenieren sie als Retter aus der Not.
Und wie damals verfängt diese Botschaft bei vielen. Wer enttäuscht ist, wer sich abgehängt oder übersehen fühlt, ist eher bereit, hartes Durchgreifen zu akzeptieren – auch wenn dafür liberale Werte über Bord geworfen werden. Hauptsache, das Gefühl von Kontrolle und „Größe“ kehrt zurück.
Dennoch ist Vorsicht geboten bei allzu simplen Vergleichen.
Europa heute ist nicht das Europa von 1933 – die Demokratie ist gefestigter, die Lebensrealitäten sind andere. Und doch lohnt der Blick in den historischen Spiegel, den uns Serien wie Babylon Berlin oder Peaky Blinders bieten.
Er dient als Mahnung, wie rasch eine offene Gesellschaft ins Kippen geraten kann, wenn Krisen und Ängste sie erschüttern. Die gedankliche Brücke zwischen den 1920er/30er-Jahren und der Gegenwart ist kein Gleichsetzen, aber ein Warnsignal. Die damaligen Serien-Charaktere ahnten oft nicht, wie knapp ihre Welt vor dem Abgrund stand – wir als Zuschauer wissen es im Rückblick besser. Diese historische Erfahrung sollten wir in die Gegenwart mitnehmen. Die aktuellen rechten Tendenzen in Europa mögen auf demokratischem Wege entstanden sein, doch sie erinnern uns daran, dass Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Gesellschaftliche Spannungen, wirtschaftliche Not und Identitätskonflikte können – damals wie heute – politische Extreme hervorbringen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich alleine mit solchen Gedanken bin, wenn ich solche Serien anschaue. Sie stellen für mich eine Gelegenheit dar, mich in diese Zeit und die mögliche Gefühlswelt der Menschen von damals hineinzuversetzen.
Die Welt von gestern spricht zu uns – leise vielleicht, aber unüberhörbar: Bleibt wachsam. Verteidigt, was euch schützt. Und nehmt den Extremisten den Nährboden, bevor daraus ein Flächenbrand wird. Nein, Geschichte wiederholt sich nicht in Reinkopie. Aber sie reimt sich. Und mancher Vers, den wir heute hören, klingt erschreckend vertraut.
Die Serien der Zwischenkriegszeit halten uns den Spiegel hin – nicht aus Nostalgie, sondern als Mahnung. Sie zeigen, wie schnell aus Gleichgültigkeit Gefahr wird.
Nutzen wir diesen Blick zurück, um klüger voranzugehen. Denn es geht längst nicht mehr nur um den Zustand der Demokratie. Vielleicht, so warnen manche, stehen wir am Vorabend eines tieferen, existenziellen Konflikts – wenn man jenen Glauben schenkt, die Russland als auferstandene, imperiale Zentrifuge begreifen. Ob Übertreibung oder Vorahnung: Die Zeichen mehren sich. Es liegt an uns, daraus Konsequenzen zu ziehen – entschlossen, bevor der Preis zu hoch wird.


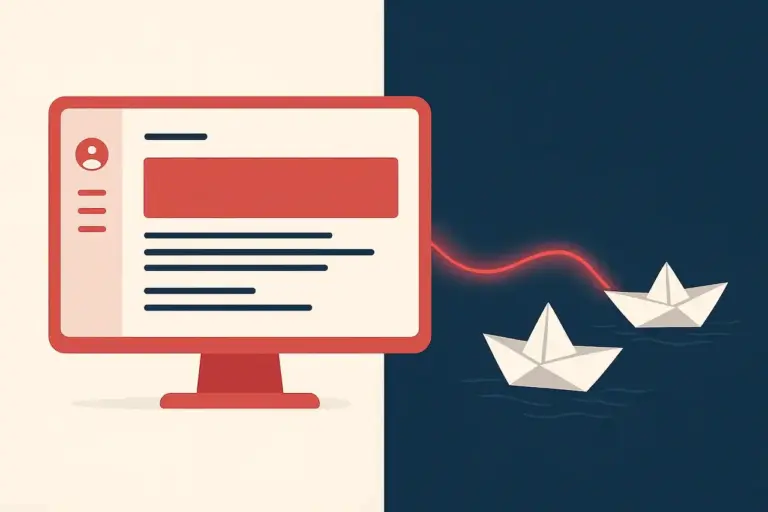
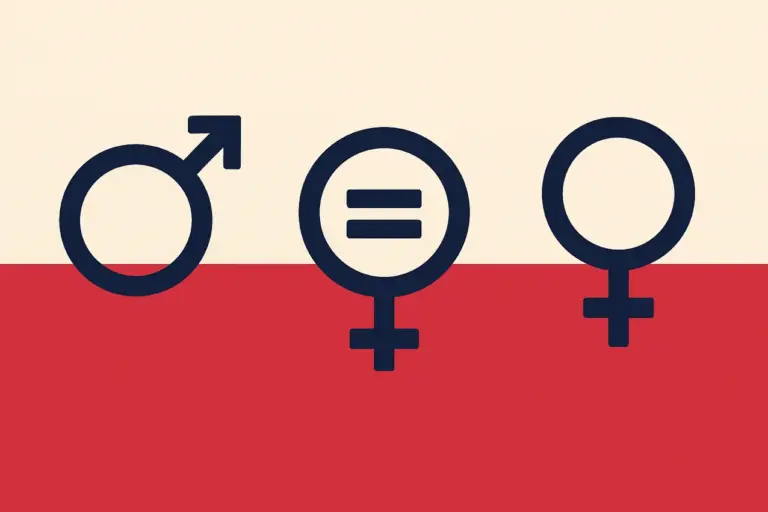





Hier im Blog werden bei Abgabe von Kommentaren keine IP-Adressen gespeichert! Deine E-Mail-Adresse wird NIE veröffentlicht! Du kannst anonym kommentieren. Dein Name und Deine E-Mail-Adresse müssen nicht eingegeben werden.