Heute stolperte ich über den Hashtag #IchbinHanna. Ich sollte mir als alter weißer Mann mit Hauptschulabschluss verkneifen, dieses Thema zu kommentieren. Wenn ich allerdings lese, wer sich alles zum Entzug des Doktortitels von Franziska Giffey (SPD) äußert, erlaube ich mir das einfach mal. Dabei ist das Wie eine zusätzlich «Inspiration».
Wie kann es sein, dass akademische Grade an Leute vergeben werden und sich nachher herausstellt, dass sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erworben wurden?
Ich spüre ein ambivalentes Gefühl nach all der Häme gegen eine Politikerin, die aus meiner Sicht gute Arbeit abgeliefert hat. Und das, obwohl mir klar ist, dass Giffey sich das ganz allein zuzuschreiben hat. Ich frage mich trotzdem, wie angemessen sorgfältig das Leitungspersonal unserer Unis bei Prüfungen von Doktorarbeiten und überhaupt bei Examensarbeiten vorgeht.
In den Corona-Monaten habe ich den Eindruck gewonnen, dass es um unsere nationale Wissenschaft gut bestellt ist. Nie kamen in einem so kurzen Zeitraum so viele WissenschaftlerInnen zu Wort. Auch wenn es leider ständig dazu kam, dass arrivierte Wissenschaftler sich gegenseitig diametral widersprachen.
Professor Lesch gab kürzlich in einer Talkshow eine Erklärung, die auch für ein schlichtes Gemüt wie meines, nachvollziehbar ist.
Nach einem kurzen und eher komplizierten Exkurs zum Thema Falsifizierung sprach er vom «Empor-Irren». So funktioniert also Wissenschaft. Vor Corona und den Erfahrungen mit der Wissenschaft während dieser Zeit habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht. Warum auch? Es ist eine andere Welt, nicht meine.
Eigentlich hat mich an den Debatten zwischen den verschiedenen Lagern weniger die Widersprüchlichkeit gestört als vielmehr die ungeeignete Form des öffentlichen Umgangs mit den bis dahin gewonnen Erkenntnissen. Dafür jedoch war nicht die Wissenschaft, sondern die Medien verantwortlich. Die medial aufbereiteten «Schlachten» enthielten Elemente, die ich als unangemessen, vor allem aber als störend empfand. Ich habe nun mal ein schlichtes Gemüt und bin selbst mit 67 arg harmoniesüchtig.
Wenn 20.000 Wissenschaftler (S4F) sich in der Klimadebatte so klar auf eine Seite stellen, ist das schon rein zahlenmäßig überzeugend. Wenn diese Wissenschaftler mit gut gemachten und überzeugenden Beiträgen (YouTube Videos, Zeitungs- und Blogartikeln) ihre Positionen erklären, spielen diese im Vergleich zu der Zahl von zwanzigtausend «wenigen» aber sehr substanziellen Auftritten eine viel größere Rolle.
Im vergangenen Jahr gab es unter dem Hashtag «95vsWissZeitVG» ein Thesenpapier. Unter Punkt 27 ist zu lesen:
Wissenschaft als Beruf hat aufgrund des WissZeitVG extrem an Attraktivität eingebüßt. Nach hervorragenden Examensprüfungen winken viele müde ab auf die Frage, ob sie eine Promotion anstreben. In einigen Fachbereichen herrscht bereits Fachkräftemangel und die Universitäten sind in Bezug auf die dort angebotenen Arbeitsverhältnisse im Vergleich mit der Privatwirtschaft nicht mehr konkurrenzfähig.
Wer berufliche Sicherheit/Perspektive braucht (subjektiv oder existenziell), verlässt früher oder später die Wissenschaft – egal wie gut er/sie ist.
Aus dem erwähnten Thesenpapier
Für mich passt diese Aussage deshalb nicht zu meinem Eindruck unserer Wissenschaft. Aber was weiß ich schon?
Ein Blick auf die vom Statistischen Bundesamt gemeldeten aktuelleren Zahlen bestätigt den behaupteten Rückgang, von dem im Thesenpapier die Rede ist, nicht. Dabei ist darin nur die Rede von «einigen Fachbereichen». Es gibt in der Aufteilung des Bundesamtes keinen Bereich (Geisteswissenschaften vielleicht. ausgenommen) mit Rückgängen.
Nach Daten der Konrad-Adenauer-Stiftung sind 480.000 Menschen in Deutschland in der Forschung tätig. Auf der Welt gibt es lediglich 2 Nationen, in denen dieser Anteil höher ist. Vor uns rangieren die USA und Japan.
Was bedeutet es für den Standort Deutschland, wenn «die ausgeprägte außeruniversitäre Forschungslandschaft», in denen die in der Pandemie auch der Allgemeinheit ins Bewusstsein geholten Institute Helmholtz-Gemeinschaft, die Fraunhofer-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und die Leibnitz-Gemeinschaft die dominierende Rolle spielen?
Deutschlands Stärken sind die Einheit von Forschung und Lehre, die Freiheit von Wissenschaft und Forschung, die Vielfalt an Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Unternehmen.
Konrad-Adenauer-Stiftung – Europa
Wie werden unsere Wissenschaftler behandelt, wenn es um die Fragen geht, die nun einmal auch in der freien Wirtschaft zu den Elementen mit überragender Bedeutung zählen? Wir lamentierten jahrelang über die «Generation Praktikum». Hat sich an den Missständen etwas geändert? Welche politischen Maßnahmen waren wirksam, welche nicht?
Wieso wurden etwaige Maßnahmen in staatlich geförderten Einrichtungen nicht zuallererst wirksam? Blieben sie etwa von ihnen unberührt? Reicht eine jährliche Erhöhung der Budgets von 3 bis 5 % aus, um die beklagten Mechanismen, die den Frust der dort tätigen Menschen zu verändern? Wie kann es sein, dass wir jetzt per erwähntem Twitter-Hashtag von diesen erbärmlichen Voraussetzungen erfahren?
Das BMBF bleibt ein zuverlässiger Partner der Forschung: Mit dem Pakt für Forschung und Innovation wird die institutionelle Förderung der Wissenschafts- und Forschungsorganisationen jährlich um drei Prozent gesteigert; ein Aufwuchs, den der Bund im aktuellen Pakt allein übernimmt. Insgesamt werden in die institutionelle Forschungsförderung im Jahr 2020 mehr als 6,7 Milliarden Euro investiert. In diesem Jahr haben Bund und Länder zudem den Pakt für Forschung und Innovation IV beschlossen, mit dem den Forschungseinrichtungen Planungssicherheit bis ins Jahr 2030 gegeben wird.
Der Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung – BMBF
Die Vorwürfe der WissenschaftlerInnen sind an das Bundesministerium für Bildung und Forschung adressiert. Welche finanziellen Mittel und Rahmenbedingungen, die Politik schaffen müsste und was diese Maßnahmen kosten würden, wird nirgends gesagt. Welche Mittel aus den diversen Haushaltstöpfen aktiviert werden könnten oder müssten, ist auch von der Beantwortung der Frage abhängig, ob es sich ein Staat mit seinen nun einmal eher begrenzten Mitteln überhaupt leisten kann, die Forschung auf Dauer zu finanzieren, ohne dass privatwirtschaftliche Quellen in nennenswertem Umfang angezapft werden. Wie bekommen die USA und Japan das hin? Dort ist der private Anteil an der Finanzierung vermutlich wesentlich größer.
Link: Wozu dient das Wissenschaftszeitvertragsgesetz? – BMBF
Link: Keine Zukunft mit Wissenschaftszeitvertragsgesetz? Keine Zukunft fürs Wissenschaftszeitvertragsgesetz! – Jan-Martin Wiarda
Wie passt eigentlich die Aussage, dass in einigen Bereichen ein Nachfragerückgang in einigen Bereichen festzustellen sei zu der Aussage, dass seit 2007 die Zahl des wissenschaftlichen Personals von 173.000 auf 256.000, gestiegen ist? Also um nicht weniger als die Hälfte. Ob diese Entwicklung in der Personalstärke womöglich ein Grund für die sich verschlechternden Bedingungen sein könnte?

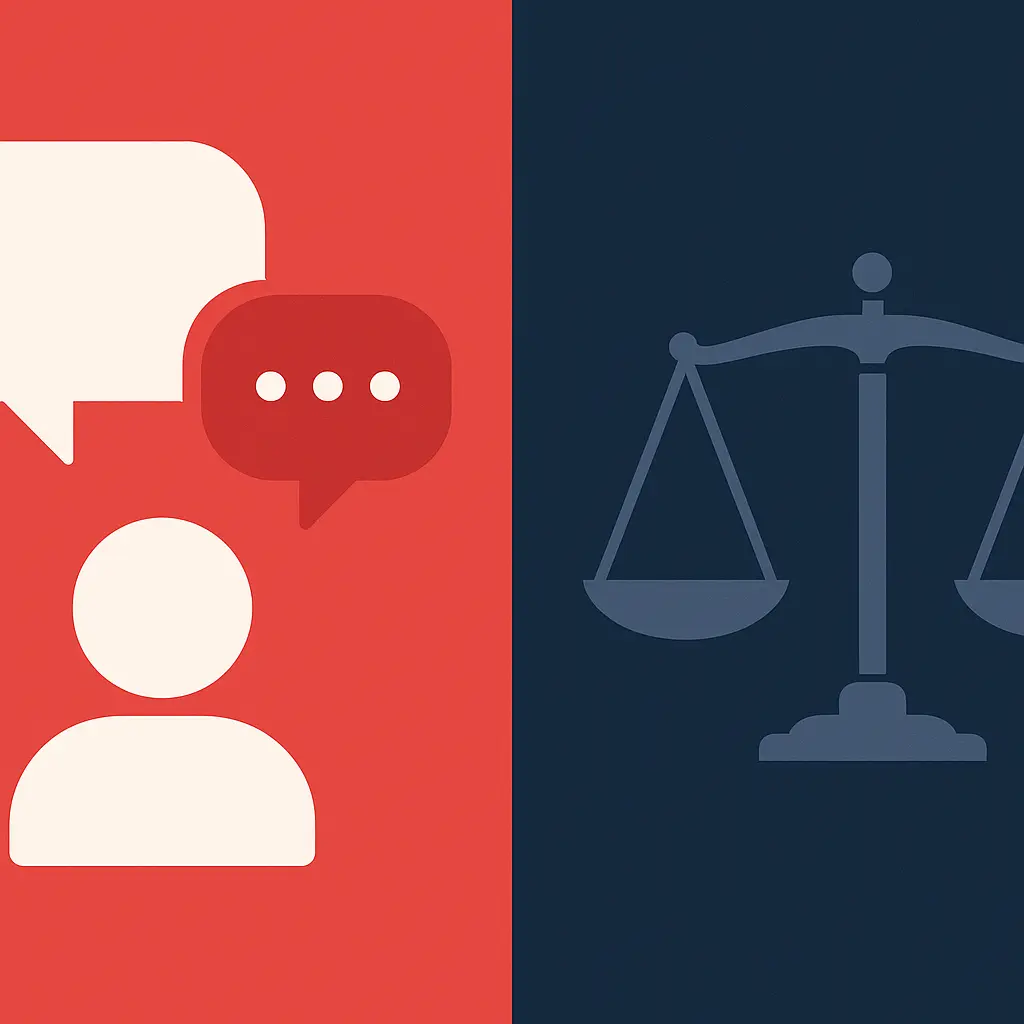

Habe vorgestern eine supertolle Vorlesung von Lesch gehört:
Wir irren uns empor
https://www.youtube.com/watch?v=u29–YNGMyg
Ansonsten: Die prekäre Situation der Nachwuchswissenschaftler/innen an deutschen Unis wird seit Jahr und Tag beklagt: Wer eine Familie gründen will, muss davon Abstand nehmen und sich einen Job außerhalb suchen. Es gibt nichts Vernünftiges zwischen dem befristeten Hiwi-Job und dem «Ruf», der jedoch nur wenige Ende 30 erreicht, die dann Prof werden zu dürfen.
Ich habs nicht pointiert genug gefragt. Gibt es vielleicht zu viele Leute, die eine Karriere in der Wissenschaft anstreben? Rein zahlenmäßig ist der Aufbau der Personalstärke (s. Artikel) ja schon erheblich. Kann der Staat das mit solchen