Sind wir noch weit von us-amerikanischen Verhältnissen entfernt? Vermutlich sind wir schon näher dran als wir uns eingestehen würden oder bereit sind, diese unangenehme Wahrheit anzuerkennen.
Das Ende der „Late Show“ mit Stephen Colbert bedeutet eine doppelte Kapitulation des Senders CBS – vor einem rachsüchtigen Donald Trump und einem Publikum, das lieber scrollt als mitzudenken.
Dialogfähigkeit: Nur noch unter Schmerzen?
Seien wir ehrlich. Immer öfter beschleicht uns das Gefühl, einander nur noch unter Schmerzen zuhören zu können. Es sei denn, die politischen oder weltanschaulichen Ansichten liegen halbwegs nah beieinander. Wehe aber, das Gegenüber zählt zum linken oder rechten Lager – dann muss der Tisch im echten Leben schon sehr breit sein, damit man sich nicht gegenseitig die Suppenschüssel über den Kopf zieht.
Dass es diesen Tisch im Internet gar nicht gibt, scheint mir einer der Hauptgründe zu sein, warum die Dinge sind, wie sie sind.
Gestern haben wir uns mit großem Vergnügen „Monsieur Claude und seine Töchter“ angesehen. Die Botschaft: Ressentiments und Vorurteile sind kein rein deutsches Problem. Überall auf der Welt menschelt es – und oft eben auf ziemlich verrückte Weise.
Warum nur fällt es uns so schwer, aus dieser schlichten Erkenntnis ein wenig Milde zu schöpfen? Warum sind wir so schnell auf 180, so schwer zur Nachsicht fähig? Vielleicht, weil die Grenze zwischen dem echten und dem virtuellen Leben immer weiter verschwimmt – und das Digitale längst unser Denken formt.
Der raue Ton der Kommentarspalten
Ich suche noch immer nach einer plausiblen Erklärung für dieses hemmungslose Übereinanderherfallen, das wir einerseits beklagen und andererseits mit vollem Einsatz mitspielen. Man sieht es an diesen Ein- oder Zwei-Satz-Kommentaren, die einem den Aufenthalt bei YouTube vergällen. Es reicht ja schon, sich durch die geistige Kost von Fleischhauer, Reitz oder anderen rechten Provokateuren zu quälen – aber wenn man dann die Fangemeinde hört, schnürt einem das die Synapsen ab.
Manche vergleichen das mit den Stammtischen früherer Zeiten. Aber ich frage mich: Hätte ich mir als junger Mann diesen verbalen Dünnpfiff wirklich jeden Sonntagmorgen reingezogen? Niemals. Unsere Väter haben das offenbar getan. Vielleicht, weil es damals noch um andere Themen ging als um rechts oder links. Vielleicht, weil man sich noch zusammenraufen konnte. Heute wäre das undenkbar.
Was uns früher zusammenhielt
Wie also haben die Menschen früher ihre „Resilienz“ aufgebaut, diese innere Widerstandskraft gegen Meinungsverschiedenheiten? Vielleicht lag es daran, dass ihnen keine tausendfach verstärkten Echokammern zur Verfügung standen, die sie in ihrer Weltsicht bestätigten – bis zur Selbstvergötzung.
Wir wissen heute: Man hätte Leuten wie Prof. Spitzer besser zugehört, als sie vor Jahren vor den Folgen digitaler Überreizung (bei Kindern) warnten. Damals wurden sie verlacht oder hart kritisiert. Heute gibt es Studien über den Einfluss des Gelesenen – oder besser: Überflogenen – auf unser Denken. Aber wer liest die schon?
KI, Regulierung und das große Missverständnis
Nein, wir machen weiter wie bisher. Und übersehen – oft mit Vorsatz –, dass wir uns auf einem fatalen Weg befinden. Beim Thema Künstliche Intelligenz geht der Streit in die nächste Runde: Die einen feiern sie als Heilsbringer, die anderen als Vorboten des Untergangs.
Heute habe ich eine Diskussion gesehen, die die deutsche Lage recht gut widerspiegelt – mit Markus Beckedahl und Bojan Pancevski. Beckedahl verteidigte engagiert, aber naiv, den Glauben an Regulierung und Kontrolle. Pancevski hingegen erklärte Europa für chancenlos – gelähmt durch seine Regulierungswut und abgehängt in den globalen Zukunftsfragen.
Ein letzter Zweifel – auch an mir selbst
Mich erinnert das an mich. An meine eigene Haltung in Konflikten: Ich sage (natürlich) nichts – aber ich zweifle innerlich an vielem, was ich selbst vertrete. Wie nur sollen wir wieder auf einen gemeinsamen Nenner kommen, ohne dass gleich jemand brüllt, es dürften keinesfalls links-grüne Narrative dominieren?
Gibt es nicht ein Dazwischen? So etwas wie das „Gefühlte Richtige“ – oder, altmodisch formuliert: gesunder Menschenverstand?
Aber dann lese ich wieder diese von mir so verachteten Kurzkommentare – und der Zweifel kommt zurück. Nicht nur an deren Verstand, sondern an die Möglichkeit, dass es je wieder besser werden könnte.
phoenix runde – phoenix – Musk, Bezos, Thiel – Die Macht der Tech-Milliardäre

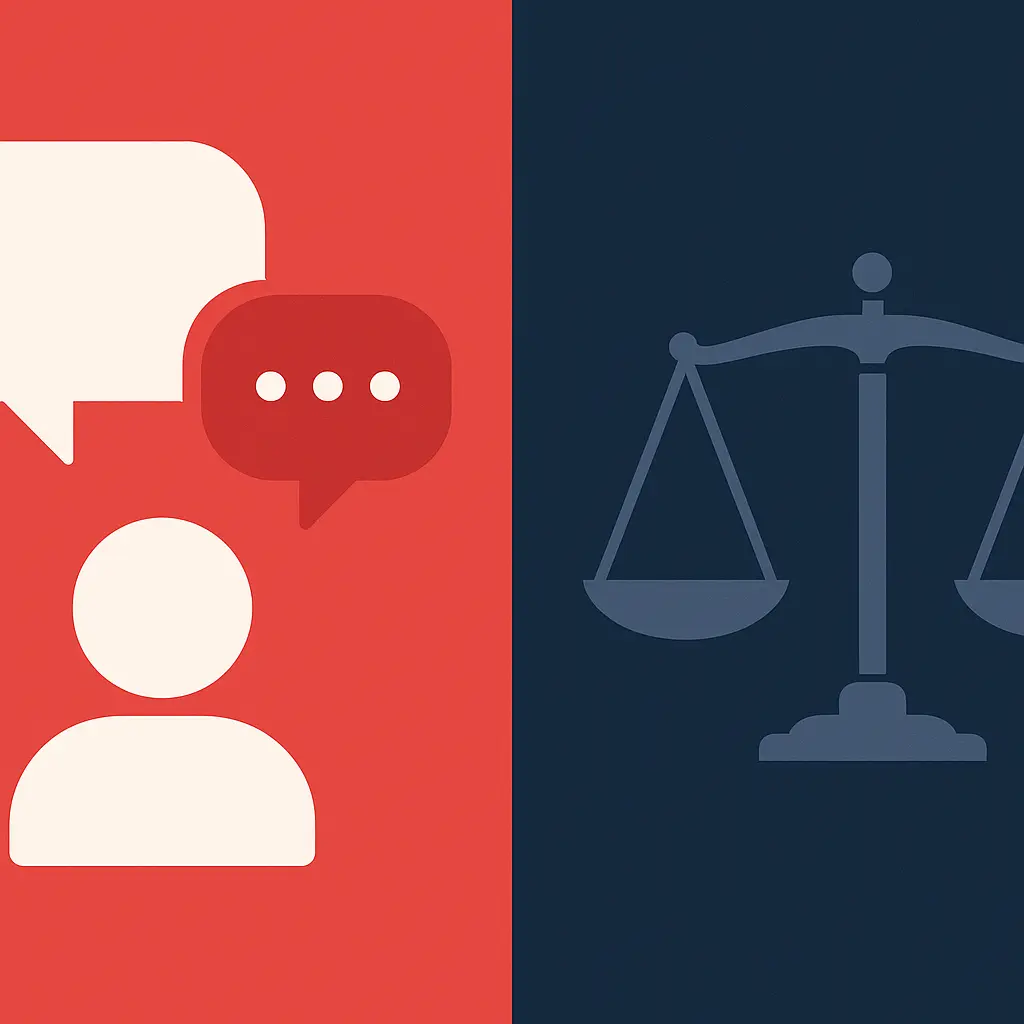

Ich weiß nicht, ob das früher so anders war. Ich denke, man hat schon früher in seiner (analogen) Blase gelebt. Alles was anders war, eben dieser Blase nicht zugeordnet, bzw. war Außenseiter. Ich erinnere mich, wie wir als Halbstarke diesem Außenseitertum mit allen Mitteln versuchten zu entsprechen. Wir waren damit genauso intolerant, wie die vermeintlichen Spießer der Dorfgemeinschaft. Ich denke, die Stammtische von früher hatten auch ihre Meinungsblase, nur eben war begrenzt auf die Kneipe. Heute sind die Stammtische öffentlich und das Internet ist ein relativ geschützter Raum. das verleitet vielleicht den ein oder anderen, verbal stärker zu agieren, als in einer öffentlichen, analogen Diskussion. Vielleicht ist die Erklärung aber auch einfach in schlechter Erziehung zu suchen; Wer sich unbedingt auskotzen musste, machte das früher nicht vor Nachbars Haustür, um mal eine Metapher zu bemühen.
@Peter Lohren: Diese Blasen des vormodernen Typus hat es gegeben 🙂 Es scheint mehr eine Frage der Reichweite der heutigen Palaverbuden zu sein, die das Unheil über uns bringt. Bei uns waren die Insignien des Andersseins ein weißes T‑Shirt und Bluejeans. Dazu sagten wir jedem, der es nicht hören wollte, wie scheiße deutsche Schlager waren. Nicht gerade ein Nachweis von Toleranz.
Haben wir früher wirklich so krass aufeinander eingedroschen, wie das heute in Kommentaren in den asozialen Netzwerken tagtäglich abertausendfach passiert? Nein, das ist eine neue, zerstörerische Qualität. Das ist wohl hauptsächlich mein Privatproblem, das vielleicht auch mit einer gewissen Isolation in meinem Rentnerdasein zu tun haben könnte. Andererseits reden viele von Polarisierung der Gesellschaft. Die habe ich nie stärker empfunden als in der Gegenwart.