Ein „Deal“, der keiner ist
Man kann es als Einigung bezeichnen – oder als Kapitulation. Die EU akzeptiert künftig einen 15-prozentigen US-Zoll auf bestimmte europäische Produkte. Im Gegenzug fließen europäische Investitionen in die USA, und amerikanische Energie wird in riesigem Umfang eingekauft. Die Rede ist von über 750 Mrd. $. Die Energieträger sind: Öl, Gas und Kohle. Ganz toll! Washington feiert den Deal als weiteren Triumph der “America First”-Strategie. Und Europa? Lächelt müde und schweigt. Jedenfalls kommt das bei mir so an.
Multilateralismus im Rückzug
Was einst als Regelwerk des Miteinanders galt – das multilaterale Handelssystem – verliert weiter an Boden. Stattdessen dominieren zunehmend bilaterale Deals, in denen der Stärkere diktiert und der Schwächere das Nachsehen hat. Die WTO? Ein Papiertiger. Freier Handel? Ein romantisches Ideal von gestern. Ich weiß, es ist schlimm so zu reden. Fast ein Abgesang auf die EU. Dabei gehöre ich nicht zu den Kritikern, die ja durchaus gerechtfertigte Kritik durch Häme und Ablehnung entwerten. Man kann das Kind auch mit dem Bade ausschütten.
Diese neue Weltordnung basiert nicht mehr auf gemeinsamen Regeln, sondern auf geopolitischen Faustregeln. Wer billig Gas verkauft oder über strategische Häfen verfügt, redet mit. Wer nicht, darf zahlen. Die künftig noch an Bedeutung zunehmenden anderen Rohstoffe (seltene Erden), also die, die nicht „nur“ zur Energiegewinnung erforderlich sind, werden die Konflikte vermutlich verschärfen. Es scheint aus jetziger Sicht wieder möglich, dass deshalb Kriege geführt werden. Die Menschheit lernt eben nicht dazu. Das stellen wir gerade in Gaza, im Jemen, in Syrien und anderen Orten unseres Planten unter Beweis.
Europas schwieriger Spagat
Für Europa ist dieser Deal mehr als nur ein wirtschaftlicher Nachteil. Er ist ein geopolitischer Offenbarungseid. Denn er zeigt, wie abhängig der Kontinent geworden ist – von amerikanischer Energie, von chinesischen Märkten, von globalen Lieferketten. Und schlimmer noch: Er zeigt, wie schwer es der EU fällt, mit einer Stimme zu sprechen. Die Segnungen der Globalisierung haben die Reichen unendlich viel reicher gemacht und die Armen nicht nur ärmer, sondern so machtlos, wie sie vermutlich nie gewesen sind. Megareiche interessieren die veränderten Bedingungen nur insofern, als sie Orte finden müssen, wohin sie ihre Milliarden schaufeln müssen. Damit nichts verloren geht.
Die unterschiedlichen nationalen Interessen und die internen Grabenkämpfe zwischen Nord und Süd, Ost und West, erschweren ein geschlossenes Auftreten. Und gerade diese Geschlossenheit wäre in einer Welt der Machtblöcke überlebenswichtig. Das wissen wir Europäer doch – oder nicht?
Belastungen, die erst noch sichtbar werden
Noch ist nicht vollends absehbar, was diese Übereinkunft die Europäer kosten wird – wirtschaftlich wie politisch. Doch eines ist sicher: Die Kosten werden kommen. In Form von höheren Preisen, möglicherweise sogar energiepolitischer Abhängigkeit – ironischerweise nicht mehr nur von Russland, sondern nun verstärkt von den USA.
Ein wirtschaftlich erzwungener Schulterschluss mit Amerika mag kurzfristig Druck vom Kessel nehmen. Doch auf lange Sicht gefährdet er das Ziel einer eigenständigen europäischen Wirtschaftspolitik. Wer sich zum verlängerten Absatzmarkt machen lässt, verliert die Kontrolle über die eigene Zukunft. Das hätte die Jünger der Globalisierung übrigens durchaus berücksichtigen können, wenn ihnen die Geldscheine nicht die Augen verklebt hätten.
Die Stunde der Europäer
Was jetzt gefragt ist, ist nicht Unterwerfung, sondern Selbstbehauptung. Europa muss – bei aller notwendigen Partnerschaft – eigene Standards setzen, eigene Industrien schützen, eigene Wege gehen.
Das setzt jedoch eine politische Kultur voraus, die nicht bei jeder Krise auseinanderfliegt wie ein Kartenhaus im Wind. Es braucht einen neuen europäischen Pragmatismus, der auf realpolitische Stärke statt moralischen Zeigefinger setzt oder auf Eigeninteressen, die wiederum von zu starken Lobbygruppen innerhalb der europäischen Nationalstaaten verfolgt werden.
Schlussgedanke
Dieser Deal ist kein Weltuntergang. Aber ein erneuter Weckruf. Für die Politik, die Zivilgesellschaft und für jeden von uns. Wir können uns nicht länger auf alte Allianzen verlassen. In einer Welt der Interessen muss Europa selbst Interessen formulieren – und durchsetzen. Sonst bleiben wir Statisten in einem Spiel, das andere beherrschen. Daran ändern die 400 Millionen Menschen im EU-Raum wenig, auch wenn das gebetsmühlenartig von EU-Politikern wiederholt wird.



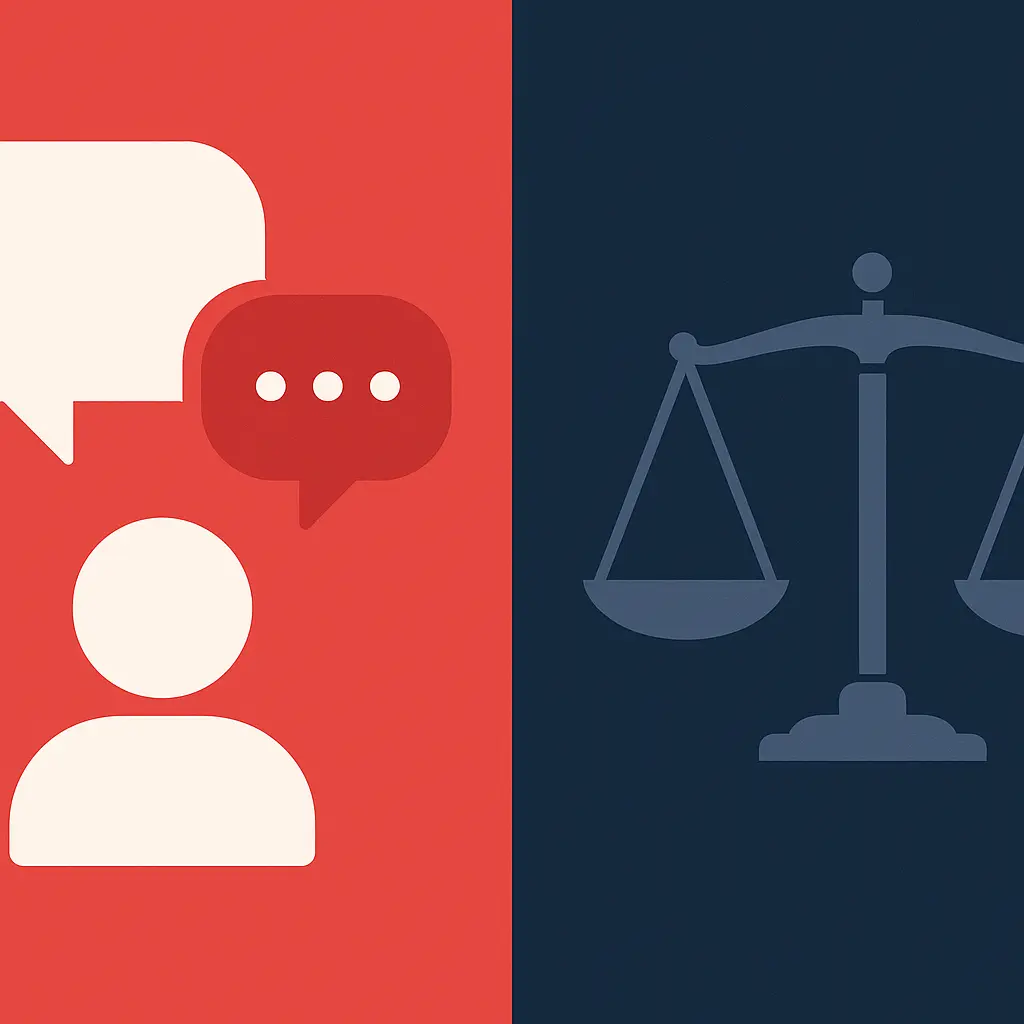
Dem ist nichts hinzuzufügen. Es bleibt allerdings die Frage offen, warum Europa so einfach einknickt. Die Folgen jedenfalls werden wir gravierend zu spüren bekommen. Das Gesamthandelsvolumen macht immerhin eine viertel Billion Dollar aus. Insbesondere der Maschinenbau ist in den USA gefragt; ein Kernbestandteil deutscher Industrie, der mit dem „Deal“ des US-Präsidenten droht unterzugehen, bzw. in die USA verlagert werden könnte. Die politische Zusage des Imports fossiler Brennstoffe könnte der Solar- und Windenergiegewinnung einen empfindlichen Schlag versetzen, letztendlich wird die sowieso schon geschwächte Automobilindustrie weiter geschwächt. Keine schönen Aussichten ….
@Peter Lohren: Es wird Leute geben, die es sich einfach machen und es auf die Stärke Trumps bzw. die Schwäche der Europäer zurückführen. Ganz so im Stil der AfD und anderer Schwätzer. Wir müssen uns fragen, ob wir nicht die Politiker haben, die wir verdienen – wenn wir schon Schwäche voraussetzen bzw. konstatieren.
Ich sehe vor allem die Gefahr, dass sich deutsche / europäische Unternehmen von solchen Lockangeboten (die auch bereits von Biden ganz offen, aber weitgehend kritiklos, initiiert wurden) leiten lassen und ihr hiesiges Engagement zurückführen werden. Investitionen in einem Land, das von einem Bekloppten regiert wird und für das es aus Gründen kaum noch eine Zukunft gibt. Die finanziellen Möglichkeiten der Amis neigen sich dem Ende zu. Das Rating AAA ist nicht nur von einer Agentur gecancelt worden, wenn ich es richtig weiß.