Es gibt diese Momente, in denen man sich fragt, ob das alles noch einen Sinn ergibt. Man schreibt, veröffentlicht, wartet – und dann: Stille. Oder schlimmer: Ein paar Klicks, ein paar Likes (wenn man denn den Zirkus der asozialen Medien noch mitmacht), aber keine Worte. Kein Widerspruch, keine Zustimmung, kein echtes Gespräch. Algorithmen sollen entscheiden, was gelesen wird. Blogger setzen die Vernetzung dagegen. Leider hat das zur Folge, dass die Selbstbespiegelung überhandnimmt. Die Dings, die Algorithmen, haben entschieden, was relevant ist und was nicht. Blogger haben, so scheint es mir, Relevanz für Blogger, selten geht es über dieses „Biotop” hinaus.
Ich schreibe schon wieder einen Artikel übers Kommentieren und Kommentare im Allgemeinen, weil die Themen rund ums Bloggen irgendwie beständig mehr Leser (und Kommentare) bringen als die Themen, die ich grundsätzlich interessanter finde. Aha!
Es stimmt, dass es lange Zeit Kommentare waren, die einen Blog lebendig machten. Nicht die Klickzahlen, nicht die Shares, sondern diese kleinen, manchmal holprigen, oft überraschenden Sätze unter einem Text. Aber „Guter Text” oder „Word” ist doch etwas wenig Kommentar. Trotzdem stellt sich die Frage: Was würde passieren, wenn sie nach und nach ganz verschwinden?
Ich durchlebe diese Phasen, auch in meiner eigenen Reflexion, immer wieder neu. Sollte man unter solchen „Voraussetzungen” nicht lieber den Kommentarbereich abschalten? Es gibt so viele Blogs (die nennen sich trotzdem Blogs!), in denen man nicht kommentieren kann. Man wird nicht durch Captchas oder andere Hürden daran gehindert, sondern der komplette Bereich ist schlicht futsch. Wir kennen große Blogs, die auf diesen Austausch mit ihren Lesern verzichten. Mir fallen spontan Fefe und Danish ein. Blogs, die ich nur sporadisch besuche, die aber – wohl aus Gründen – auf Kommentare verzichten. Es gibt viel mehr davon und sie haben hohe Besucherzahlen – das unterstelle ich jedenfalls bei diesen Beispielen.
Die Illusion der Nähe
Früher war es einfach. Man schrieb etwas, und irgendwer antwortete. Nicht immer klug, nicht immer freundlich, aber es war ein Zeichen: Hier ist jemand. Hier denkt jemand mit. Heute wird diskutiert, woanders. In geschlossenen Gruppen, in flüchtigen Threads, in Echokammern, die uns vortäuschen, wir wären alle einer Meinung. Gut, das ist jetzt nicht ganz so… Doch was bleibt, wenn die Kommentare unter einem Artikel nur noch aus drei Worten bestehen: „Genau meine Meinung!“ – oder gar aus einem einzigen Emoji? Wir haben die Technik, um uns zu vernetzen, aber wir verlieren die Kultur des Zuhörens. Dabei braucht es genau das: Orte, an denen man nicht nur konsumiert, sondern sich einmischt. Wo man nicht nur scrollt, sondern stehenbleibt.
Der Preis der Bequemlichkeit
Es ist verlockend, sich zurückzulehnen. Warum kommentieren, wenn man auch schnell ein Herzchen drücken kann? Warum diskutieren, wenn doch die nächste Outrage-Welle schon wartet? Doch wer nur noch likt, statt zu reden, gibt etwas auf: die Chance, sich zu irren, zu lernen, sich zu streiten – und am Ende vielleicht sogar zu verstehen. Blogs waren immer auch ein Experimentierfeld für den öffentlichen Gedankenaustausch. Nicht perfekt, oft chaotisch, aber ehrlich. Wenn wir das aufgeben, überlassen wir das Feld denen, die lauter schreien als nachdenken. Und die sind selten die Interessantesten.
Was bleibt, wenn alle schweigen?
Ich habe in den letzten Wochen viel über Kommentare nachgedacht. Nicht nur, weil sie weniger werden, sondern weil sie etwas verraten: über uns, über die Themen, die uns bewegen, über die Art, wie wir miteinander umgehen. Manchmal sind es die kleinen, unscheinbaren Reaktionen, die zeigen, dass ein Text angekommen ist. Ein „Das habe ich auch so erlebt“ oder ein „Da sehe ich das anders“. Das sind auch nur kurze Sätze. Ich finde, es sind keine leeren Floskeln, sondern Brücken. Vielleicht sind es gerade die unbequemen Kommentare, die uns weiterbringen – die uns zwingen, unsere Argumente zu schärfen oder unsere Haltung zu überprüfen. Was ich nicht gut finde, sind ein paar knappe Worte und ein eingefügter Link. Man mag das als Aufforderung verstehen, sich tiefer mit der Thematik zu befassen. Ich verstehe solche Beispiele als ziemlich unverblümten Hinweis darauf, was man von meiner Sichtweise hält.
Dabei geht es nicht um Nostalgie. Es geht um die Frage, was wir eigentlich wollen: Ein Netz, das uns bestärkt in dem, was wir schon denken? Oder eines, das uns herausfordert, das uns zwingt, uns auseinanderzusetzen? Ich glaube, wir sollten uns wehren gegen die Stille. Nicht aus Prinzip, sondern weil wir es besser können. Weil ein echter Dialog mehr wert ist als tausend stumme Klicks.
Und ja, ich weiß: Es ist einfacher, nichts zu sagen. Wer hat nicht schon darüber nachgedacht, was das bringt, für eine Handvoll Menschen einen Text zu erstellen, der von der Idee bis zur Fertigstellung (auch mit KI) eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt? Einfluss haben Blogger selten. Gelegentlich kommt es mal vor. Aber ich spreche da auch nicht von Formaten, die vielleicht die gleiche Software (WordPress) benutzen, sondern von semiprofessionellen, oft politisch orientierten Blogs, die sich aufgrund ihrer Konzeption vollständig von dem Bloggen unterscheiden, das wir betreiben.
Links zum Weiterlesen:
- Kommentar erwünscht? – Zwischen digitaler Nähe und technischen Hürden
- Wir und die Anderen: Wie der Dialog verloren ging
- Leckt mich
Häufigkeit und Kontext
- Anzahl der Beiträge: Mindestens 10 Beiträge (seit Juli 2025) thematisieren direkt oder indirekt das Thema Kommentare, Kommentarkultur oder den Dialog im Netz.
- Zeitliche Verteilung: Besonders konzentriert im Juli und August 2025.
- Kommentare pro Beitrag: Die Anzahl der Kommentare variiert stark:
- Höchstwert: 17 Kommentare („Leckt mich“)
- Durchschnitt: ~8 Kommentare bei Beiträgen, die explizit Kommentare oder Dialog thematisieren
- Keine Kommentare: Bei einigen Beiträgen, die das Thema nur streifen (z. B. „Ulrich Reitz: Für mich sind Sie das Reizthema in der Causa Brosius-Gersdorf!“)
Thematische Schwerpunkte
Erkenntnis: Blogs bleiben wichtig für Nischen-Dialoge, auch wenn die Kommentare weniger werden.
Kommentarkultur im Wandel
Beispiel:Kommentar erwünscht? – Zwischen digitaler Nähe und technischen Hürden
Inhalt: Analyse des Rückgangs von Blogkommentaren, technische und kulturelle Gründe, Wunsch nach offener Kommunikation.
Erkenntnis: Technische Hürden und veränderte Nutzergewohnheiten (z.B. Social Media) reduzieren die Kommentare.
Dialog und gesellschaftliche Spaltung
Beispiel:Wir und die Anderen: Wie der Dialog verloren ging
Inhalt: Warum echte Gespräche seltener werden, Empörungskultur, Verlust des gesunden Menschenverstands.
Erkenntnis: Polarisierung und Empörung dominieren den Austausch, sachlicher Dialog leidet.
Persönliche Erfahrungen mit Kommentaren
Beispiel:Leckt mich
Inhalt: Umgang mit Hasskommentaren, Entscheidung, den Blog aus einem Netzwerk auszutragen.
Erkenntnis: Aggressive oder unangemessene Kommentare führen zu aktiven Gegenmaßnahmen.
Bloggen als Plattform für Austausch
Beispiel:Bloggen in Deutschland – Zwischen Verschwinden und Verwandlung
Inhalt: Rolle von Blogs als Ort für Kommentare und Vernetzung, trotz rückläufiger Zahlen.
Entdecke mehr von Horst Schulte
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E‑Mail zu erhalten.
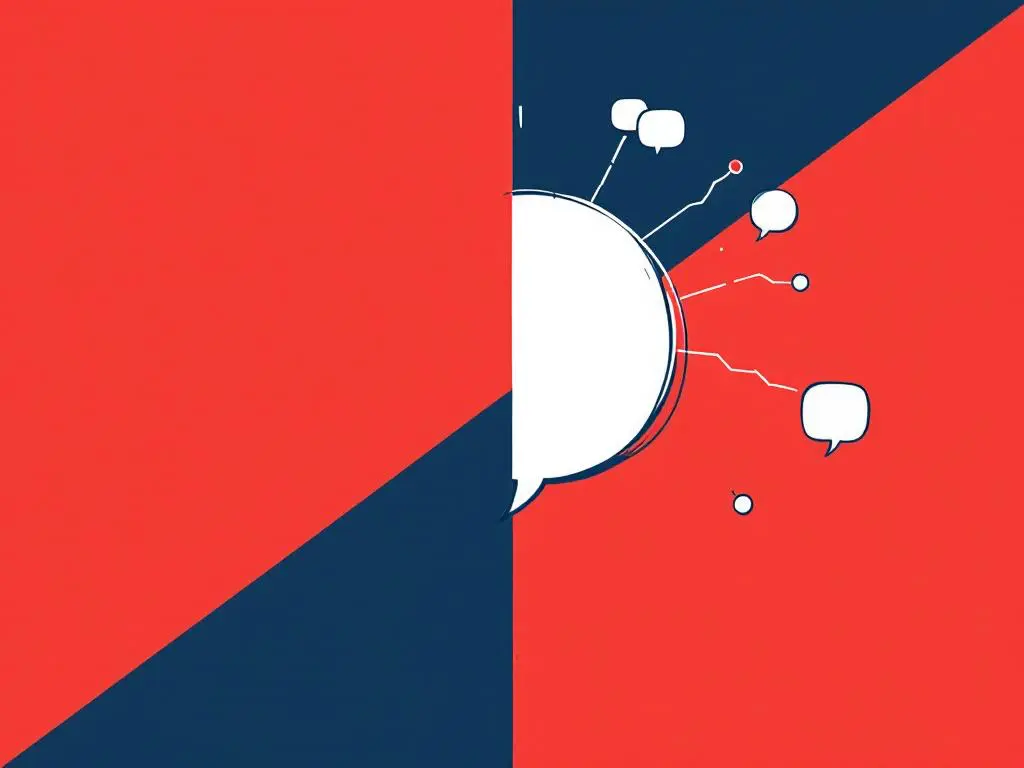
Mir steht nur wenig Zeit für das Lesen eurer Beiträge zur Verfügung, das ausführliche Kommentieren kriege ich nicht hin
@T.Head: Das verstehe ich. Warte ab, bis du Rentner bist. Dann kannst du loslegen. Allerdings musst du darauf achten, nicht zu viele Ehrenämter wahrzunehmen. Dann brauchst du wieder einen Terminkalender 🙂
@T.Head: Ich bin zwar kein so guter Kommentierer, muss Horst aber recht geben. Als Rentner hast du alle Zeit der Welt!