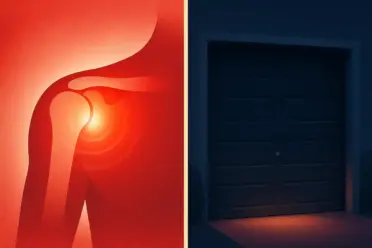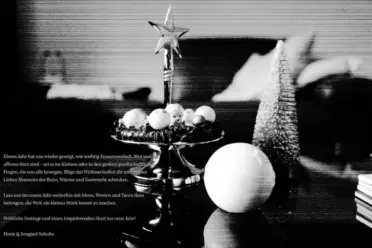Neuste Artikel
Anonyme Geister und andere Blog-Wunder
Als erfolgreichen Versuch kann ich die Zeitspanne, in der ich das anonyme Kommentieren hier im Blog, zugelassen habe, nicht bezeichnen. Über den Daumen waren es während der letzten Jahre ca. 70 Kommentare, die anonym hinterlassen wurden. Das spricht dafür, dass viele Besucher doch »alte« Bekannte sind und ihre Meinung hierlassen. …alles lesen
Ein Leser, der sich „Kai“ nennt und mir bisher unbekannt war – ohne Nachname, ohne Mailadresse, – hat mir heute einen Gedanken vor die Füße geschmissen, den ich in meiner Euphorie über den Einsatz KI-unterstützter Texte wahrhaftig übersehen hatte. Vielleicht auch, weil ich hier bislang weder im Kommentarbereich noch im …alles lesen
Weihnachtsmärkte werden 2025 selten abgesagt, aber fast überall teurer und sichtbarer gesichert. Poller, Sperren und Kontrollen prägen das Stadtbild. Ursache sind reale Anschlagsrisiken – nicht „rassistische Narrative“. Politik muss Kommunen bei Sicherheitskosten entlasten. …alles lesen
Länder, die sich nicht dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) unterstellen, sind unter anderem die USA, China, Russland und Indien. Auch Israel erkennt die Zuständigkeit des IStGH nicht an. Diese Länder sind entweder nicht dem Römischen Statut beigetreten oder haben es zurückgezogen. …alles lesen
Die Kritik an Hendryk Streeck lenkt den Blick auf eine Schieflage im Gesundheitssystem: Bei Medikamenten für Ältere wird laut skandalisiert, während teure Operationen selbstverständlich bleiben. Anhand der Geschichte einer Nachbarin stellt der Text grundsätzliche Fragen zur medizinischen Versorgung. …alles lesen
Da sage noch mal einer, bei Markus Lanz könnte man nichts lernen. Ich wusste nicht, dass Seltene Erden ein Missverständnis darstellen. Die Elemente sind weder selten, noch handelt es sich um Erden. Und für Mobiltelefone werden von diesen »Seltenen Erden«, die gar nicht so selten und die auch keine Erden …alles lesen
Like oder Dislike – das war hier die Frage
Ich fand es nett, wenn man Artikel und Kommentare in einem Blog mit einem Plus/Minus oder Daumen nach oben oder unten bewerten kann. Deshalb habe ich hier ein Plug-in eingesetzt, das genau diesen Zweck erfüllt. Eben habe ich es abgeschaltet. Alle Artikel von gestern und heute wurden liebenswürdigerweise mit einem …alles lesen
Kritik an Kanzler Merz wird oft mit seinem fehlenden Regierungsamt vor dem Kanzleramt begründet. Doch diese biografische Fixierung ersetzt die inhaltliche Auseinandersetzung. Entscheidend sind seine politischen Entscheidungen – nicht, welche Titel früher auf seiner Visitenkarte standen. …alles lesen
In der Rentendebatte bei „Markus Lanz“ prallen Junge Union, SPD und Ökonom Hans-Werner Sinn aufeinander. Es geht weniger um tatsächliche Rentenkürzungen als um langsamere Steigerungen, um 120 Milliarden Euro – und um einen politischen Sprachkampf, der Vertrauen kostet. …alles lesen
Die Sache mit den Sozialausgaben
„Wenn du eine Mehrheit von 168 Sitzen hast und trotzdem bestimmte Kürzungen bei den Sozialausgaben nicht durchbekommst“, sagte mir ein Stratege aus der City, „dann sind die Märkte zu dem Schluss gekommen … dass es keine Chance gibt, die öffentlichen Finanzen wieder ins Lot zu bringen.“ Quelle Dies bezieht sich …alles lesen
Ich kritisiere Correctivs Klöckner-Artikel: Reposts werden vorschnell als Bekenntnisse gewertet, Medien zu schnell als „rechts“ gelabelt und Klöckners Rolle überhöht. Zugleich blendet Correctiv seine eigene staatliche Förderung aus. Ergebnis: Vielleicht ist dies eine wichtige Recherche, allerdings doch mit deutlicher Schlagseite. …alles lesen
Bei mir läuft ein stabiler 100-Mbit-Anschluss der Telekom, doch politisch und wirtschaftlich gilt DSL als Auslaufmodell. Gleichzeitig drängt die Deutsche Glasfaser mit zweifelhaftem Service in den Markt. Ein persönlicher Versuch, dieses Breitband-Theater zu sortieren. …alles lesen
Ein persönlicher Streifzug von Kindheitsabneigungen über deftige Winterküche bis zur heutigen Vorliebe für mediterrane Gerichte – mit einem liebevollen Blick auf familiäre Prägungen und kulinarische Wandlungen. …alles lesen
Heute ist schon der 18. November. Trotz der üblichen miesepetrigen Wetterlaune geht’s in diesem Jahr noch. Die Bäume sind noch nicht alle kahl und der Regen – naja, er hält sich in Grenzen. Große Lust auf Draußen (Fotos machen) habe ich allerdings nicht. Es gab Jahre, in denen ich im …alles lesen