Die USA sind heute nicht mehr in der Lage sich auf eine Wirklichkeit zu einigen und deshalb sind sie auch nicht mehr in der Lage Probleme zu erkennen zu analysieren und zu handeln.
(Klaus Brinkbäumer, ehemaliger Spiegel-Chefredakteur, Autor des Buches:
«Im Wahn: Die amerikanische Katastrophe»)
Was glauben Sie, wie weit Deutschland von dieser traurigen Zustandsbeschreibung noch entfernt ist? Reden nicht viele auch bei uns gern von Polarisierung der Gesellschaft? Aber vielleicht ist das nur eine Übertreibung bezogen auf die USA, ein vor allem durch die erratische Politik Trumps hervorgerufenes Unwohlsein, das bei näherer Betrachtung nicht standhält?
Ich verstehe von dem, was in den USA geschieht zu wenig, um mir darüber ein Urteil erlauben zu können. Dass mich so mancher Bericht (nicht nur die ein bisschen übertrieben scheinenden von Elmar Theveßen) über die Vorgänge in den USA erschüttert hat, werden viele nachvollziehen können. Dass es in Europa und Deutschland viele Menschen gibt, die Trump und sein Wirken gut finden, überrascht und provoziert mich immer noch, obwohl ich mich inzwischen an verquere Sichtweisen gerade auch während der Corona-Pandemie gewöhnt habe.
Jetzt auch in Europa und Deutschland
Ich sehe gegenüber der amerikanischen Demokratie ein paar Vorteile in Deutschland, die trotz meiner begrenzten Kenntnisse über US-Verhältnisse ins Auge stechen. Da wäre zunächst einmal das Mehrparteiensystem, das auch nicht nur positive Seiten aufweist, das trotz der bei Republikanern und Demokraten existierenden breiten politischen Strömungen vielleicht weniger zu polarisierenden Effekten tendiert.
Ich finde es nicht gut, dass US-Präsidenten in der Regel aus Familien stammen, die nicht nur Einfluss, sondern auch wahnsinnig viel Geld besitzen. Man kann sagen, in den USA wird niemand Präsident, der nicht sehr reich und dessen Familie nicht über großen Einfluss verfügt. Vielleicht war Präsident Obama eine Ausnahme? In den letzten Jahrzehnten gibt es jedenfalls genug Beispiele, die meine Behauptung stützen können.
Dass Präsident Reagan mithilfe der Mafia ins Amt kam, ist nicht weniger erschütternd als manch andere Personalie. Dass Leute, die an der Spitze der Nahrungskette stehen, für normale Bürger wenig tun, klingt doch nur auf den ersten Blick nach boshafter Unterstellung eines Antikapitalisten. Warum konnte Trump Präsident werden? Doch nur deshalb, weil bestimmte Bevölkerungsgruppen in den USA von allen demokratischen Parteien seit Jahrzehnten grob vernachlässigt wurden.
Für solche Dramen ist das politische System in Deutschland nicht gemacht. Der Vorteil der auf zwei Amtsperioden begrenzten Präsidentschaften in den Vereinigten Staaten dagegen, fällt positiv ins Gewicht. Angela Merkel ist immer noch Bundeskanzlerin. Es gibt nicht wenige im Land – auch mit Einfluss – die sich sogar heute noch eine weitere Amtszeit Merkels vorstellen können. Ich fände es gut, wenn die Amtszeiten der deutschen Regierungschefs ebenfalls auf zwei Legislaturperioden begrenzt wären.
Nur zwei Legislaturperioden für Spitzenpersonal
Dass wir in den letzten Jahren beinahe durchgängig von einer Großen Koalition regiert wurden, ist nicht nur aus demokratietheoretischen Gründen ein Problem. Wir haben bei wichtigen Fragestellungen der letzten Jahre (Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Pandemie) schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Der Einfluss der Opposition und der Parlamente war zwischendurch sogar derart reduziert, dass man die Unterstützung der GroKo-Parteien brauchte, um die zahlenmäßige Unwucht etwas zu reduzieren. Wie schlecht das funktioniert, sehen wir am Verhalten der GroKo, wenn es um die Arbeit in Untersuchungsausschüssen geht – wenn diese denn überhaupt konstituiert wurden.
Wer geglaubt hat, dass die GroKo immer die richtigen Antworten geben wird und deshalb zum Wohle unseres Landes arbeiten würde, der dürfte inzwischen eines Besseren belehrt worden sein. Es ist, glaube ich, schon etwas daran, dass wir Bürgerinnen und Bürger in Deutschland ein bisschen zu viel darauf vertrauen, dass der Staat es schon richten wird.
Wir überdehnen den Sozialstaat, in dem wir immer mehr Geld hineinstecken, auf der anderen Seite aber nur wenig darauf achten, wie effizient das viele Geld wirkt. Es dauert oft endlos lange, bis auf Fehlentwicklungen reagiert wird. Inzwischen liegt die Größenordnung für den Sozialausgaben pro Jahr in Deutschland bei über einer Billion Euro! Diese Zahl stammt noch aus der Vor-Corona-Zeit! Jetzt scheint das Koordinatensystem (Schwarze Null) vollständig aufgehoben.
Das Land, in dem Milch und Honig fließen
Für die Maßnahmen der Regierung habe ich Verständnis, ich finde es mitunter jedoch befremdlich, mit welcher Selbstverständlichkeit und Anspruchshaltung manche Gruppen unserer Gesellschaft Forderungen an den Staat richten. Kann das auf Dauer funktionieren? Was passiert, wenn die hohe Verschuldung trotz des noch «billigen» Geldes dazu führt, dass Sozialleistungen massiv gekürzt werden?
Ich finde, von Roger Köppel (schweizerische Weltwoche) kommt gewöhnlich nicht allzu viel Kluges. Aber er hat den Vorteil der direkten Demokratie in einem Beitrag einmal sehr schön zusammengefasst.
Im Vergleich mit Ländern wie Frankreich oder Deutschland brauchte es keine starken Führungspersönlichkeiten (Macron, Kurz), die zuerst einmal in ihre jeweilige Position gebracht werden mussten, nachdem das stetige anschwellende Missfallen und Rumoren der Gesellschaft nicht mehr überhört werden konnte. In der Schweiz werden systembedingt politische und gesellschaftliche Wünsche nach Veränderungen behutsam und interessanterweise auch schneller nach vorn entwickelt.
Ein großer Vorteil der direkten gegenüber der parlamentarischen Demokratie · Horst Schulte
Etwas mehr von der Schweiz
Das ist mein Traum. Nicht die politischen Parteien würden nach ihrem Gusto regieren, sondern sie hielten sich daran, was der Souverän verlangt. Dass es in Deutschland anders ist und die Wahlen – auch ganz unabhängig von niedrigen oder hohen Wahlbeteiligungen – nicht wirklich viel bewirken, sollten wir an der Zusammensetzung unseres Parlaments erkennen. Damit meine ich nicht das Auftauchen der AfD, sondern die Zustände, die durch die GroKo fast zementiert wirken.
Finanzkrise
Auch wenn dieser Text einen anderen Schluss nahelegt, es ist nicht so, dass ich persönlich ein Problem mit Merkels Regierung hätte. Ich war für die Maßnahmen der Regierung während der Finanzkrise. Allerdings bin ich sehr enttäuscht davon, dass über Akutmaßnahmen hinaus, nichts von einer zukunftsweisenden Politik innerhalb der Eurogruppe und der EU insgesamt zu sehen ist. Deutschland spielt dabei keine gute Rolle. Man wollte mit den getroffenen Maßnahmen Zeit gewinnen. Die hat man bekommen, zielführende Lösungsmodelle jedoch nicht. So wird das irgendwann eintreten, was die mir sehr unliebsamen Kassandras der Szene seit Jahr und Tag an die Wand malen.
Energiepreise
Als Merkel die Energiewende mit dem Ausstieg aus der Kernenergie eingeleitet hat, gab es keinen politischen Widerstand. Man könnte behaupten, Merkel habe das Momentum für die Entscheidung genutzt. Die Umfragen waren nach Fukushima ja völlig eindeutig. Nur, dass sich daran kaum einer erinnern will.
Dass wir heute in Deutschland die höchsten Strompreise weltweit zahlen und die Regierungen manch anderer Länder die deutsche Entscheidung mit Kopfschütteln quittieren, interessiert den siegesgewissen Mainstream nicht.
Mit einer milliardenteuren Deckelung der EEG-Umlage hat die Bundesregierung deutlich höhere Strompreise im nächsten Jahr verhindert – dauerhaft spürbare Entlastungen für Verbraucher und Firmen aber sind nicht in Sicht.
Dauerhafte Entlastung bei Strompreis nicht in Sicht – Wirtschaft weltweit – Pforzheimer-Zeitung
Welche Implikationen mit dieser Tatsache verbunden sind, steht bei alldem nicht im Fokus. Es wird nicht darüber diskutiert, weil ja immer noch davon ausgegangen wird (sowas wie eine Staatsdoktrin), dass Deutschland als Vorbild bei den erneuerbaren Energien gilt.
Wie die Chinesen und Inder mit ihren Kohlekraftwerken, die schon allein deshalb nicht stillgelegt werden, weil in dieser Industrie Millionen von Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen.
Flüchtlingskrise
Auch in der Flüchtlingskrise bilden wir uns ein, Vorbild sein zu müssen. Ich bin ganz ehrlich. Ich hätte alle Flüchtlinge von Moria aufgenommen. Ich halte diese Hilfe für unsere Pflicht als Menschen. Mein Wille scheitert aber schon am Widerstand meiner Frau. Sie sagt: «Wir können nicht alle aufnehmen». Was soll ich darauf erwidern? Wir hätten es bei den 15.000 bewenden lassen und uns dann geweigert, Flüchtlinge – sagen wir von Samos – aufzunehmen? So ist das mit meinem gutmenschlichen Gehabe. Einerseits würde ich (das ist mein Ernst) jedem Menschen in Not helfen, andererseits gibt es viele – nicht nur gute – Argumente gegen meine Haltung.
Das wäre auch ein klarer Fall für die direkte Demokratie. Einem Votum würde ich mich unterwerfen. Aber dazu kommt es nicht, weil wir mit unseren etwas über 82 Millionen Einwohnern dafür angeblich ja nicht gestrickt sind. Ein paar andere ernstzunehmende Gründe gegen direkte Demokratie gibt’s sicher. Selbst dann, wenn sie von der falschen Seite kommen.
Corona
Während der Pandemiebekämpfung erwarb sich unsere Regierung einen guten Ruf. Inzwischen scheinen doch leider viele eine Möglichkeit für sich entdeckt zu haben, sich durch Fundamentalopposition ins «rechte Licht» zu rücken. Zum Glück gibt es Meinungsumfragen. Sie zeigen ein immer noch überraschend klares Bild, das die Maßnahmen der Regierung insgesamt trägt. Vielen scheint die Striktheit der Maßnahmen sogar noch nicht weit genug zu gehen. Vielleicht ist das typisch für eine Gesellschaft mit hohem Durchschnittsalter? In anderen europäischen Ländern (Frankreich, Italien und Spanien) ist das scheinbar auch so.
Es gibt die Ebene der Politik und die des Volkes. Oppositionsparteien und regional Zuständige offenbaren in diesen Zeiten nicht unbedingt Geschlossenheit.
Premier Johnson glaubt übrigens, dass die Corona-Lage in seinem Land deshalb so unterschiedlich im Vergleich zu anderen europäischen Staaten wäre, weil die Briten besonders freiheitsliebend seien. Wahr ist, dass in Großbritannien sehr unterschiedliche Maßnahmen gegen Corona praktiziert werden. Die Londoner Zentralregierung hat in vielen Regionen des Landes keinen Einfluss mehr. Auch in Spanien versuchen konservative Parteien der linken Regierung am Zeug zu flicken – allerdings ziemlich erfolglos.
Eine alternde Bevölkerung im Land bedeutet nicht, dass sie weniger kritisch im Umgang mit den Anti-Corona-Maßnahmen wäre, sie ist nur definitiv umsichtiger und vorsichtiger. Der ältere Teil der Bevölkerung steht den Maßnahmen ihrer Regierung eher positiv gegenüber, während viele jüngere Leute eher kritisch dazu stehen. Daraus abzuleiten, dass die einen Ja-Sager oder die anderen unverantwortliche Idioten wären, spiegelt leider ein typisches Beispiel für unsere Zeit.
Austausch von Meinungen, freie Meinungsäußerung
Die Demokratie lebt vom Austausch unterschiedlichen Meinungen, von der Balance zwischen Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit. Vor allem aber lebt sie von Demokraten. Nun könnte man fragen, ob die Leute, die sich so für die «strengen» Maßnahmen der Regierung im Kampf gegen die Ausbreitung der Pandemie ins Zeug legen, Demokraten sind. Ich meine, angesichts der staatlichen Eingriffe könnte man auf die Idee kommen, dass vielen dieser Leute ihre persönliche Sicherheit weitaus wichtig ist als ein paar demokratische Grundrechte. Ich denke, sie alle handeln auf der Basis eines großen Verantwortungsgefühls.
Es sind viele, zuletzt über 30%, denen die Maßnahmen der Regierung noch nicht weit genug gehen. Vielleicht nimmt angesichts der zweiten Welle die Zahl derer ab, die weiter gegen die Maßnahmen sind und die deshalb das Gegenteil fordern. Nämlich, dass sich der Staat gefälligst nicht in dieser bevormundenden Art und Weise einmischen soll. Wenn man den Umfragen glaubt, kann die Zahl derer, die eher für Freiheit und gegen staatliche Fürsorge sind, nicht so groß sein. Aber die sagen was ganz anderes.
Dass viele Juristen sich zur Sache kritisch äußern, also zum Beispiel sagen, dass die «Regelungen» des Infektionsschutzgesetzes unzureichend sind, hilft all denen aufs Pferd, die aus dieser Krise ihre ideologischen Vorteile ziehen wollen. Der Frage, ob wir Bürgerinnen und Bürger dem Staat gegenüber «Gefolgsamkeit» schuldig sind, lässt sich höchstens mit Umfragen begegnen. Außerdem haben der Staat und seine Vertreter, unterstützt durch viele Sachverständige eine Lage erzeugt, über die sich trefflich streiten lässt. Der Historiker, Professor Nolte, sagt zum Beispiel:
Das Verhältnis zwischen Bedrohung, Angst und dem Sicherheitsversprechen des Staates ist heikel. Vor allem dann, wenn die Bedrohungsdiagnose auch politisch befördert wird.
Corona-Krise: Gefahr für die Demokratie? Interview mit Historiker Paul Nolte | Politik
Da hat er sicher einen Punkt. Im Interview erwähnt Nolte mit keinem Wort die Tatsache, dass überall auf der Welt ähnliche Verhältnisse gelten – jedenfalls in den demokratisch verfassten Staaten. Aber das scheint für Juristen und Historiker offenbar bedeutungslos. Auch die Ärzte, die Gegenpositionen einnehmen – wie zuletzt der Ärztepräsident höchst selbst – scheinen sich an einem Spezialwissen zu orientieren, das dem Otto-Normalbürger nicht zur Verfügung steht. Oft ist es allerdings so, dass sich alle Empfehlungen darauf beschränken, alle Maßnahmen der Regierung einfach fallen zu lassen. Das mag jeder bewerten wie sie oder er möchte. Für mich ist dieses Meckern ohne Alternativen zu nennen, einfach bloß daneben!
Asoziale Medien verändern die Demokratie
All diese Herausforderungen finden in einer Umgebung statt, die sich durch die brutale Wettbewerbssituation zwischen herkömmlichen und digitalen Medien stark verändert hat.
Entweder werden wie in den USA, Ungarn, Polen und der Türkei Demagogen ins Amt gewählt, die die Rechte von Minderheiten mit Füßen treten, oder eine Regierung verschanzt sich, freiheitliche Rechte garantierend, hinter technokratischen Entscheidungen – und verliert wie in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zunehmend an Volksnähe.
Yascha Mounk, deutsch-amerikanischer Politologe
Politische und gesellschaftliche Gewissheiten zerbröseln. Das fördern die asozialen Netzwerke nach Kräften.
Facebook nutzt die Profilbildung, um sie als Instrument zur Steuerung von Meinung seiner Nutzer zu nutzen.
Dem Wahlkampfteam von Donald Trump standen 2016 bis zu 60.000 Datensätze pro Wähler (Quelle: Julius van de Laar, Strategieberater) zur Verfügung. Bei Obama waren es 2012 ca. 20.000 Datensätze je Wähler. Mit solchen Datenmengen lassen sich in der Vorbereitung zu Wahlen sicher einige Dinge über die potenzielle Wähler herausfiltern und für erfolgreiche Kampagnen zu nutzen. ¯\_(ツ)_/¯
Wir wissen darüber inzwischen genug, um die Gefahren richtig abschätzen zu können. Konsequenzen aus diesem Wissen ziehen wir aber nicht. Es ist den meisten egal, wie der manipulative Charakter der SN-Systeme auf die Demokratie wirkt. Das ist ein krasser und unlösbarer Widerspruch zu der Diskussion um den Datenschutz bei der Corona-Warn-App.
Das Politiker versuchen, der Entwicklung durch die Bekämpfung von Symptomen (Hass) Einhalt zu gebieten, ist rührend. Leider kann das aus meiner Sicht schon allein deshalb nicht gelingen, weil die Zahl der Nutzer und damit automatisch auch derjenigen, die diesen Hass predigen, schlicht und einfach zu hoch ist. Bei solchen Zahlen, mit denen wir es in den asozialen Medien zu tun haben, finden sich keine adäquaten Mitteln, um das Phänomen wirksam zu bekämpfen. Diesen Kampf wahlweise dem asozialen Netzwerk oder dem Staat zu überlassen ist wahnwitzig und ist aussichtslos. Es besteht längst die Gewissheit, dass die Technik definitiv zur Beeinflussung demokratischer Prozesse genutzt werden.
Auch dann, wenn es Radikalen in den genutzten asozialen Netzwerken zu viel Restriktionen werden sollten, haben sie natürlich Ausweichmöglichkeiten. Auch dann, wenn die Reichweite vorerst geringer ist als in Netzwerken wie Twitter und Facebook sind die unbotmäßigen, menschenverachtenden Botschaften unbehelligt dort zu platzieren. Die Betreiber schert das einen feuchten Kehricht. Sie entfalten auch bei Telegram, Tik Tok oder wie sie alle heißen mögen ihre unheilvolle Wirkung.
Neben den Problembereichen, die ich hier aufgelistet und aus meiner Sicht kommentiert habe, gibt es eine Vielzahl weiterer Dinge, die die Menschen im Land sehr unterschiedlich sehen und bewerten. Vielleicht ist es so, dass allein die Menge von Herausforderungen mit ihren daraus entstehenden Unsicherheiten dazu führt, dass wir ganz anders darüber diskutieren als das früher ™ der Fall gewesen ist. Wir sind unduldsam und hören uns gegenseitig nicht mehr in dem Maße zu, wie es in einem Diskurs vonnöten wäre.
Poltische Magazine erklären nicht, vorzugsweise prangern sie an
Eine Voraussetzung dafür, dass die Gesellschaft wieder zusammenrückt, wäre zum einen die Reduktion einer immer nur wachsenden Komplexität. Das sagt sich so leicht. Außerdem könnte man mir vorhalten, dass die dabei irrtümlich davon ausgehe, dass viele Menschen Ursachen und Zusammenhänge der vielen Probleme nicht verstehen würden. Ist es so anmaßend, das zu behaupten? Oder trifft es nicht einen wichtigen Punkt?
Nehmen wir das Beispiel Klimawandel. In Bedburg Rhein-Erft-Kreis gibt es für die Grünen keine Schnitte zu gewinnen. Der Grund ist vielleicht der, dass die Partei sich nicht an Beschlüsse voriger Regierungen gebunden fühlte und sich aus opportunistisch wirkenden Gründen auf die Seite von Friday for Future schlug. Wir sehen, dass direkte Betroffenheit von politischen Maßnahmen Rückwirkungen aufs Wählerverhalten haben kann. In den vom Kohleausstieg betroffenen Gebieten in Ost-Deutschland (Lausitz) ist dieser Zusammenhang noch viel deutlicher.
Mainstream ist das Leid der anderen
Bei den Kommunalwahlen lagen die Ergebnisse der Grünen zwischen 5 und 8%. Die Zahlen sind auch, aber nicht allein, damit zu begründen, dass die Grünen es im Osten grundsätzlich schwerer hätten als hier im Westen.
Es gibt den Zusammenhang zwischen dem Wahlverhalten der Menschen in den betroffenen Regionen und der Politik der Grünen. Es ist klar, dass das auch genauso sein sollte. So funktioniert Demokratie. Da die Arbeitsplatzverluste in den Regionen nicht überall gleichermaßen wirken, sind die Ergebnisse der Grünen in umliegenden Gebieten oft viel besser.
Grüne
Die Grünen stehen mit ihrem Thema im Licht, also in der Gunst der Zuschauer. Vielleicht ist das so, weil sie es verstanden haben. Die Volksparteien (angeblich ja ein Auslaufmodell) haben es von jeher als ihre Aufgabe gesehen, die großen gesellschaftlichen Themen unseres Landes «abzudecken». Inzwischen sind diese Themen aber so komplex und undurchdringlich geworden, dass selbst Bundestagsabgeordnete zugeben, dass sie nicht wissen, worüber sie eigentlich abgestimmt haben. Die Grünen haben sich nicht verzettelt. Sie bearbeiten vor allem Umweltthemen. Wie weit das allerdings trägt, bleibt abzuwarten. Spätestens, wenn sie als Teil der nächsten Bundesregierung Verantwortung tragen, wird sich zeigen, wie es um ihre Substanz bestellt ist.
Veränderungen wecken Skepsis
Die Angst um Arbeitsplätze allein ist es jedoch nicht, die die Polarisierung auch bei diesem Themenfeld so stark antreibt. Die Stimmen derjenigen werden lauter, die die Energiewende insgesamt für eine grundfalsche Entscheidung halten. Wir erleben, wie sich die Energiepreise entwickeln. Wir nehmen in Europa längst die Spitzenposition ein. Diejenigen, die in dem aus sicherheits- und klimapolitischen Gründen betriebenen Projekt ihre ideologische Basis haben (also vor allem die Grünen) nutzen die große Verunsicherung der Menschen in Sachen Klimawandel, um den kostenträchtigen Umbau, von dem nicht ausgemacht ist, welche Auswirkungen er auf lange Sicht für unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit haben wird, durchzusetzen.
Da die Umfragen und Wahlergebnisse der Grünen beachtlich sind, ziehen andere Parteien nach, weil sie von diesem Trend profitieren wollen. Verfolgt man nun die Social-Media-Diskussionen, so bekommt man leicht den Eindruck, dass es mit dieser großen Zustimmung zum energiepolitischen Projekt der Grünen vielleicht doch nicht so weit her ist.
Ich bin gespannt, wie die deutsche Autoindustrie, deren Krise lange vor Corona begonnen hat, sich behaupten wird. Wer vermag wirklich zu sagen, welcher Teil diese Krise verursacht hat? Lag es am allgemeinen Schlechtreden der rückständigen deutschen Autoindustrie (vor allem in unseren Medien) oder dem hysterischen Vorwurf, dass der Umbau zu anderen Antriebsformen politisch nicht hinreichend gefördert wurde. Wer auch immer zu verantworten hat, dass wir vielleicht die rund 800.000 Arbeitsplätze plus x durch die Auswirkungen irgendwelcher Fehler ausgleichen müssen, der Änderungsprozess ist im Gange.
Stabil genug?
Ob sich die Politik in den umstrittenen Sektoren als falsch erweist oder nicht, ist für die Frage nach der Stabilität unserer Demokratie nicht so relevant. Wir wissen, wie unterschiedlich die Leute über die großen Linien der Politik denken. Wir neigen nicht wirklich dazu, unseren Standpunkte durch das Wirkenlassen anderer Argumente zu ändern. Wir streiten uns auf allen Social-Netzwerk-Kanälen; ich wünschte, es gäbe noch den Disput am Stammtisch. Der war oft nicht weniger boshaft, dafür aber weitaus geringerer Durchschlagskraft. Akute Anfälle individueller Dummheit blieben gewissermaßen isoliert.
Für sich genommen werden die unterschiedlichen Sichtweisen und die reaktiven Wirkungen des Staates oder seiner Institutionen, egal wie restriktiv sie unter den jeweiligen zeitlichen Gegebenheiten auch sein mögen, nicht so wirken, dass die Demokratie ins Wanken gerät. Aber machen wir uns nichts vor: Sie gehören zu den Elementen, die das Klima zwischen den am Diskurs beteiligten Gruppen nachhaltig negativ beeinflussen.
Ich behaupte, eine Demokratie bedingt einen funktionierenden Sozialstaat.
Wer kann beweisen, ob die USA deshalb keine Demokratie ist, nur weil dort ein Sozialstaat in unserem Sinne NICHT existiert? Viele europäische Länder haben einen Sozialstaat. Dass diese Sozialstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt sind und wirken, liegt wohl vor allem daran, wie die jeweiligen Bevölkerungen ihn begreifen. Bürger in anderen europäischen Staaten mögen staatliche Bevormundung nicht. Allein dieser Tatsache werden die Unterschiede geschuldet sein.
Ich habe Schweden immer als besonders sozialstaatlich organisiertes Land wahrgenommen. Während der Corona-Krise habe ich gelesen, dass dort über 80jährige keine Chance mehr haben, im Notfall auf die Intensivstation zu kommen. In Großbritannien werden Menschen über 65 keine neue Hüfte mehr bekommen. Dort wird über diese Besonderheiten überhaupt nicht diskutiert. Die Bevölkerung betrachtet die bestehenden Regeln als völlig normal. Was bei uns in Deutschland los ist, wenn etwas in dieser Art auch nur angesprochen wurde, haben Philipp Mißfelder oder Boris Palmer erlebt.
Mit Druck und Haltung andere Meinungen unterdrücken
Wenn davon gesprochen wird, dass die Basis unserer Demokratie erodiert, weil große Gruppen unserer Gesellschaft nicht mehr miteinander diskutieren wollen, stößt man aktuell auf den Begriff «Cancel Culture». Spätestens an diesem Punkte sollten alle hellhörig geworden sein. Dass vor allem Rechte sich darüber beklagen, heißt nicht zwangsläufig, dass der Vorwurf als solcher unberechtigt ist. Ich werde die Beispiele der letzten Zeit nicht aufführen. Aber es sind zu viele davon, als dass man dieses Phänomen einfach ignorieren oder bestreiten sollte. Grüne und Linke tun das aber.
Sie anerkennen nicht, dass – egal wer – für seine Äußerungen in Wort oder Bild nicht aus dem öffentlichen Angebot entfernt werden darf. Jedenfalls dann nicht, wenn man sich selbst als Demokrat bezeichnet. Mich erinnern die Maßnahmen (über den Streit sind wir schon hinaus) an die Bücherverbrennungen im dritten Reich. Nur, dass dieses Sakrileg in unseren Zeiten nicht von der SA exekutiert wird, sondern von virtuellen Trupps in den sozialen Netzwerken. Und zwar, das kann ich mir nicht verkneifen, meistens von denen, von denen ich es am wenigsten erwartet hatte. Von Linken!
Ich möchte wetten, dass es die gleichen Leute sind, die damals unter lautstarken «Je suis Charlie»-Rufen die Solidarität mit Charlie Hebdo bekundet haben, nun unliebsame Bücher mit gewissen Tendenzen zu unterdrücken suchen. Das ist indiskutabel!
All diese Scharmützel stecken wir weg. Aber, wie ich schon schrieb, die Entwicklung unserer Diskursverhinderungskultur kann ein Klima bereiten, das keiner von uns wollen kann.
Wenn es in Deutschland aufgrund von Corona und der wachsenden Digitalisierung zu Massenarbeitslosigkeit kommt, dürfte eine intakte Diskussionskultur von größtem Nutzen sein. Wenn die Sozialsysteme (Arbeitslosengeld, Hartz IV, Renten) kollabieren, weil nicht mehr genügend Menschen sozialversicherungspflichtiger Arbeit nachgehen, ist der Weg für Feinde der Demokratie frei. In diesem Fall werden uns auch all die furchtbaren Erfahrungen unserer Vorfahren nicht mehr davor schützen und die Institutionen (Verfassung, EU), in die wir (teilweise) heute unser Vertrauen setzen, werden es ebenfalls nicht richten.

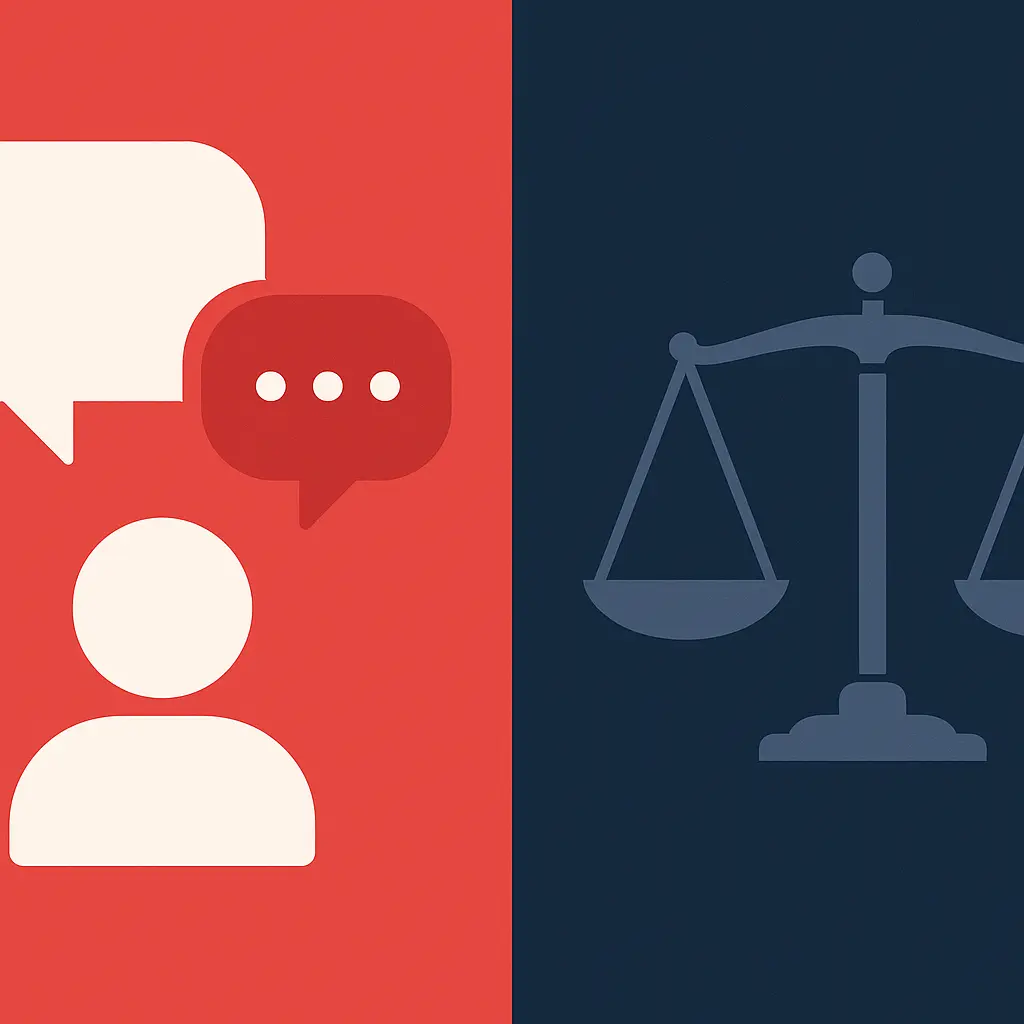

du könntest doch auswandern, vielleicht gefällt es dir woanders viel besser.
Wenn ich dann von Qualitätskommentaren wie deinem verschont bliebe, wäre es eine Überlegung wert. Aber ich fürchte, solche Sichten wie deine sind universal.
Ach Horst, was hast Du denn da für einen komischen Otto angelockt? Sowas braucht doch niemand 😀
Ich bin noch nicht fertig mit dem Lesen, den Rest hebe ich mir für heute Abend auf. Aber definitiv ein richtig toller Artikel!
Danke Martin. Das ist wohl der länge Artikel, den ich hier je geschrieben habe. Hoffentlich finden sich noch ein paar substanzielle Meinungen dazu ein. Ich würde mich natürlich freuen.
Wow, was für ein toller Artikel! Es ist selten, dass jemand mal den großen Rundumblick wagt!
Zu einzelnen Punkten:
Social Media: Wenn man die Umfragen mit dem persönlichen Eindruck vergleicht, den mensch auf Twitter von der Debattenkultur und der Anzahl von «Hasspostings» gewinnt, so zeigt sich regelmäßig ein recht großer Unterschied: Die Zahl der «Hassprediger» ist bei weitem nicht so hoch, wie es scheint. Schon eine recht kleine Gruppe kann einen ordentlichen Shitstorm entfachen, wenn sie koordiniert (das geht auch recht spontan) vorgeht.
Ich habe ja selbst z.B. mehrere Twitter-Accounts (für diverse Blogs einen je eigenen), ohne es je darauf angelegt zu haben, eine «Mengenwirkung» vorzutäuschen. Denkt man das weiter, kann jeder «Hassprediger» locker 20 Accounts bedienen, zusammen mit Gleichgesinnten multipliziert sich das schnell – und wenn die alle in diesselbe Kerbe hauen, erweckt das schnell den Eindruck, sie seien die Mehrheit oder zumindest «sehr viele».
Klimawandel/Arbeitsplätze: Das ist ein lebensweltliches Dilemma, das die Politik nicht einfach lösen kann, egal welche Partei. Die «Substanz der Grünen» wird mit Sicherheit weniger sichtbar, wenn sie in der Regierung sind – das ist zu erwarten und kaum verhinderbar.
Menschen mögen keine Veränderungen und viele hängen an Arbeitsplätzen, selbst wenn diese nicht besonders angenehm und umweltschädlich sind. Ich habe nie wirklich verstanden, warum in der Vergangenheit z.B. mehr Subventionen in die Kohle geflossen sind als es gekostet hätte, alle dort Beschäftigten bis an ihr Lebensende zu bezahlen! Und selbst konnte ich mich auch «arbeitslos» immer problemlos beschäftigen, hatte da sogar meine politisch aktivsten (und sogar wirksamsten!) Zeiten. Aber ich muss akzeptieren, dass das nicht repräsentativ ist – also fällt mir auch nur ein, möglichst viel Unterstützung beim Umstieg und Ausstieg zu leisten (=Sozialstaat).
Was du nicht beschrieben hast:
Insgesamt ist der Handlungsspielraum unserer Regierenden sehr viel begrenzter als viele in der Bevölkerung denken! Was da oft für Forderungen kolportiert werden, zeigt aus meiner Sicht ein massives Defizit an politischer Bildung. «Merkel muss weg» ist nur das krasseste Beispiel, da gibts Leute, die echt glauben, dann wär «alles gut».
Dass die Politik an Rechtsstaatlichkeit gebunden ist – was das bedeutet und WIE diese weiter entwickelt werden kann, darüber scheint wenig bekannt (Juristerei ist Herrschaftswissen, nach wie vor).
Dass sie darüber hinaus eingebunden ist in EU-Verträge (und darüber hinaus an internationales Recht), beschränkt den Handlungsspielraum sehr – und genau das ist ein Punkt, den rechtsradikale Kräfte mit Erfolg aufgreifen können. Polen und Ungarn haben den Anfang gemacht und sich um manches nicht geschert, was eigentlich als EU-NoGo gilt. Was passiert? Wenig…
Erdogan dreht grade wieder durch – aber gibt es nicht immer noch die «Beitrittsperspektive» und entsprechende Zahlungen? Ab und an wird da etwas zeitweilig «ausgesetzt», wenn ich recht erinnere… schon allein, dass ich (als fast News-Junky) es nicht weiß, spricht Bände!
Manchmal denke ich, eine zweistufige EU wäre mittlerweile besser: eine Kern-EU, die etwas stringenter agiert – und andere drumherum, mit denen man sich nicht über alles einigen muss.
So, erstmal belasse ich es dabei, es ist ja schier unmöglich, zu allem was zu sagen, was du angesprochen hast! (das schreckt vermutlich auch eigentlich Kommentierwillige ab – lass dich dadurch nicht demotivieren, der Artikel ist super und sehr anregend!
Danke, Claudia. ༼ つ ◕_◕ ༽つ
Ich mach mir keine Illusionen darüber, wie die asozialen Netzwerke politisch instrumentalisiert werden. Das geht in jede politische Richtung. Gerade weil Bots, gezielte Kampagnen u.s.w. eine bedeutende Rolle spielen, das dies macht ihre Existenz nicht weniger gefährlich. Sogar dann nicht, wenn man sich all die manipulativen Versuche jeder erdenklichen Seite permanent ins Bewusstsein ruft. Das Internet und dort vor allem die asozialen Netzwerke haben einen vielleicht unumkehrbaren, sicher aber sehr destruktiven Impact auf alle, die sich darin bewegen. Ich verstehe ja, dass diese Medien einen Reiz ausüben und schon deswegen von vielen vehement verteidigt werden. Ich bin damit durch. 🙂
Ich hatte zwei Phasen mit Arbeitslosigkeit, unter denen ich sehr gelitten habe. Sie dauerten jeweils mehrere Monate an. Da packt einen die nackte Existenzangst. Dass wir diese Zeit unbeschadet überstanden habe, ist im Nachhinein etwas, das mich ein bisschen stolz macht. Aber ich habe das Gefühl präsent und weiß, wie furchtbar solche Erfahrungen sind. Man braucht Glück und ein Umfeld, das einen dadurch trägt.
Die notwendigen Veränderungen haben nur ein ganz anderes Kaliber, als all die Dinge, die wir bislang (eher konjunkturgetrieben und branchenspezifisch) nicht kannten. Die Leute spüren – auch wenn sie es nicht unbedingt thematisieren – dass gewaltige Veränderungen auf sie zukommen. Mitgenommen werden sich dabei schlussendlich die wenigsten fühlen. Nicht zuletzt aus diesem Faktum heraus wird sich eine starke Opposition bilden, die leider von Ideologen für ihre Zwecke ausgenutzt wird. Ich denke dabei jetzt nicht an die Grünen. Die Frage ist jedoch, ob sie – als die Treiber dieser Veränderungen – über die Substanz verfügen, solche Prozesse zu moderieren. Diese Moderation wird nämlich nötig sein.
Es ist zum Teil erschreckend, was manche Leute für Vorstellungen in politischen Fragen äußern. Was sie freilich nicht daran hindert, sie laut und überzeugt in die Öffentlichkeit zu pusten. Was von denen kommt, die sich so ungern selbst als Rechts titulieren lassen, ist hanebüchen. Meine Beurteilung beruht nicht auf der Einbildung, dass ich immer richtig liege, sondern auf so plakativen Aussagen, wie du sie in deinem Kommentar erwähnt hast («Merkel muss weg»). Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass sie vielleicht besser noch 4 Jahre dranhängen sollte. Nur wird sie uns den Gefallen wohl nicht tun. Sie wird uns mit solchen Idioten allein lassen, die gerade ihr wahres Gesicht für alle deutlich gezeigt werden. Strauß ist eben überall – jedenfalls in der Union.
Ich danke dir für den ergänzenden und ebenfalls anregenden Kommentar zu meinem (wohl längsten) Beitrag ever. Ich bin mir fast sicher, dass die meisten ihn nicht lesen, weil er viel zu lang und am Ende wohl auch zu wenig strukturiert ist. Besser kann ich es halt nicht. Ich habe ganz schön lange dran gesessen (❁´◡‹❁)
Noch ein separates Wort zu Erdogan. Die EU hätte dafür sorgen sollen, dass alle Botschafter aus Ankara abgezogen werden. Die Finanzhilfen zur Vorbereitung von weiß ich was sollten eingestellt werden. Alle Verhandlungen ebenfalls. Die deutsche Regierung sollte die Hermes-Bürgschaften auf Eis legen. Die Türkei zum Sperrgebiet für Urlauber erklärt werden.
Was ich noch ganz vergessen hatte, aber unbedingt zum Thema gehört: Ist Demokratie überhaupt noch als oberster politischer Wert anzusehen? Was, wenn Demokratie das Nötige nicht mehr liefern kann, weil zu wenige mitmachen?
Ich komme drauf, weil gerade auf Twitter eine kleine Debatte über «Ökodiktatur» läuft.
https://twitter.com/BerdSalz/status/1321421006624460801 (plus Kommenare). Beispiel-Argument:
«Ökodiktatur ist unsere einzige Überlebenschance. Die Maßnahmen, die eigentlich erforderlich sind, werden niemals demokratisch durchgehen.»
Das nur so als weitere Ergänzung.
Das steht im Grunde über allen Sorgen. Wir erleben das in den USA. Dort existieren zwei Wirklichkeiten. Keine der beiden sie vertretenen Gruppen können sich auf die jeweils andere einlassen. Das hat zur Folge, dass nichts mehr weitergeht. Genau daran kann eine Demokratie scheitern. Die meisten Menschen werden nämlich unter diesen Voraussetzungen «die Lust» verlieren, überhaupt noch mitzumachen, zur Wahl zu gehen, ganz zu schweigen davon, sich irgendwie für eine politische Partei zu engagieren. Ich glaube, dass zuerst einmal die Verfahren in unseren politischen Parteien genauer angesehen werden müssten. Was ist gut, was kann weg? Was erwarten wir BürgerInnen eigentlich Politik? Vielleicht kommt man schnell darauf, dass es weniger darum geht, den Leuten nach dem Mund zu reden, sondern darum, dass Lösungsangebote möglichst von glaubwürdigen und charismatischen Persönlichkeiten unterbreitet werden, die nicht Rücksicht auf den Zeitgeist nehmen, sondern die nachvollziehbar von dem Interesse geprägt sind, die Dinge nach vorne zu entwickeln. Sehen wir das bei einem einzigen Punkt, der die Menschen heute so verunsichert? Nein, die Politiker weichen aus und reden im Grund dem, was sie für die Mehrheitsmeinung halten, hinterher.
So, Horst, ich habe es endlich geschafft, den längsten Artikel ever™ zu lesen 🙂 Wie Claudia schon schrieb, ist es eigentlich unmöglich, auf alle Punkte einzugehen. Aber Du hast Einiges sehr gut herausgearbeitet.
Als Grundprobleme der Entwicklungen – auch für die Demokratie – , wie sie seit einiger Zeit immer stärker hervortreten, habe ich für mich persönlich hauptsächlich 2 Dinge ausgemacht:
1. Informationsüberflutung und Überkomplexität
2. Bildungsdefizite
Die Sozialen Netzwerke (SN) und überhaupt das World Wide Web haben es geschafft, innerhalb weniger Jahrzehnte die Informationsvielfalt um mehrere Zehnerpotenzen zu vervielfachen. Was da an Informationen auf jeden Einzelnen niederprasselt, ist nicht mehr handlebar und kann nur noch gefiltert konsumiert werden. Diese Filter schafft sich entweder jeder selbst oder sie werden ihm vom Algorithmus des jeweiligen SN vorgegeben. Beides hat Nachteile: nicht jeder ist in der Lage, sinnvoll zu filtern und lebt in seiner Filterbubble – wenn allerdings der Filter vom Sozialen Netzwerk kommt, ist es genauso gefährlich, denn dann entscheiden andere, was Du und ich sehen sollen. Eher schlichtere Gemüter können vielleicht auch nicht über den Tellerrand hinausschauen und sind in einer Blase aus Hildmann, AgD, «Merkel muss weg!» und Klimaskeptizismus gefangen. Zumal dann noch die entsprechenden (oftmals falschen) Telegram-Kanäle als mediale Sättigungsbeilage dazukommen.
Das ist aber nicht nur ein deutsches Problem, in anderen hochentwickelten Industrienationen ist das ähnlich. Die USA sind da ja mal echt die Krönung, da wurde der Begriff «Infowars» begründet und er findet statt, tagtäglich. Die Rechtspopulisten in allen Ländern machen sich diese Fakten-Explosion gerne zunutze, indem sie einfache Antworten auf immer komplexere Fragen anbieten, die sich allerdings als komplette Luftnummer herausstellen, wenn es um die Wurst geht: was kam von der AgD denn Substanzielles während der Corona-Krise? Außer einem Brandtner, der es total OK findet, ohne Maske im Zug zu fahren und sich auf dem Klo einzuschließen, wenn die Polizei ihn fragen will, was der Scheiß soll. Mehr kommt da nicht. Ach ja, und natürlich, dass sie grundsätzlich «dagegen» sind. Gegen alles. Gegenvorschläge? Konstruktives? Fehlanzeige.
Und schon sind wir bei der Komplexität. Was früher™ noch überschaubar war – man hat Zeitung gelesen und die Tagesschau geguckt – ist heute unübersichtlich und verwirrend. Stündlich ändert sich die Welt und man erfährt davon in Echtzeit. Wo früher am Stammtisch, wie Du sehr passend geschrieben hast, mal die Fetzen geflogen sind, weil in der Blöd-Zeitung ein Aufreger-Artikel stand, sind es heute Strukturen und Systeme, die nicht mehr verstanden werden können. Zumal niemand mehr weiß, wer denn eigentlich noch «Recht hat». Ist es der Hildmann? Oder doch der Drosten? Gibt es eine Verschwörung im großen Stil? Oder weiß einfach nur niemand, wie zu agieren ist? (um mal beim Beispiel der Corona-Krise zu bleiben). Aber keine Sorge: die Blöd-Zeitung und die AgD wissen, wie’s geht!
Dazu kommt die Dummheit der Menschen. Meine Mutter hatte mal gesagt: «Früher in der Schule konnte selbst das dümmste Kind in unserer Klasse richtig lesen und schreiben.» Da ist was dran. Die absoluten Basics sind heute oft nicht vorhanden, da kann dann auch nichts mehr draus erwachsen. Die Leute verblöden leider immer mehr.
Jetzt bin ich aber auf das Thema Deines Artikels eigentlich noch gar nicht eingegangen. Das werde ich jetzt nachholen 😉
Um die Frage aus der Überschrift zu beantworten: eher nicht. Warum? Weil ich unsere Demokratie in Deutschland, die nach dem 2. Weltkrieg «designt» wurde, für ziemlich resilient erachte. Das parlamentarische System, die Gewaltenteilung und die Tatsache, dass es keinen allmächtigen Kanzler oder Präsidenten gibt, sind schon ziemlich harte Waffen gegen ein Kapern der Demokratie durch extreme Kräfte. Die Zustimmungswerte zu den Altparteien™ sprechen ja auch eine klare Sprache. So schlimm können sie also nicht sein, denn sonst würden sie ja nicht gewählt werden. Die Extremen am rechten Rand haben zwar auch Prozente, aber zum Glück nicht genug, um zu regieren. Und das ist auch gut so.
Wie können wir die Demokratie stärken? In meinen Augen durch Bildung und einen gut funktionierenden Sozialstaat. Denn es war doch schon immer so: arme, kranke, arbeitslose und abgehängte Menschen wählen extreme oder populistische Parteien und Politiker, weil sie auf die Versprechen der Bauernfänger von Reichtum, Geld, Gesundheit und Anerkennung hereinfallen. Siehe Trump und Bolsonaro. Die Realität sieht leider anders aus, denn außer blöden Sprüchen und Großmaulerei kommt da schon wieder nichts.
Die Politik sollte insgesamt verbindlicher, menschlicher, nachvollziehbarer und konsequenter auftreten. Und versuchen, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln. Hier ist einfach Pädagogik gefragt, um Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Denn nur der, der die Dinge versteht, fällt nicht auf Lügen herein. Und das geht auch nur, wenn man die Sorgen der Bevölkerung ernst nimmt und bereit ist, in den Dialog zu treten (aber Du weißt ja: mangelnde Bildung, mangelndes Interesse, etc. stehen dem wieder entgegen – da beißt sich die Katze in den Schwanz).
Zum Schluss noch ein Land, das meiner Meinung nach vieles richtig macht: Neuseeland. Hier wurde Jacinda Ardern mit großer Mehrheit bestätigt, weil sie eine menschliche Politik macht, die außerdem gut verständlich ist. Für mich ist Neuseeland eines der großen Leuchtfeuer der modernen Demokratie.
Keine Regierung und keine Regierungsform sind perfekt. Aber die Demokratie ist die menschlichste Art, zu regieren, denke ich. Und deswegen kann und darf und sollte man zwar die Prozesse immer wieder infrage stellen und kritisieren, aber nicht die Demokratie als solche.
Okay, meine Zeilen hätten auch ein eigener Blogartikel werden können, so ist es ein Kommentar unter einem wirklich hervorragenden Artikel geworden! 🙂
Martin, vielen Dank für diesen langen Kommentar. Es freut mich, dass der schrecklich lange Text überhaupt eine Resonanz bekommt.
Die Sache mit der Komplexität scheint für viele einfach unlösbar. Noch vor kurzem hatte ich einen TV-Beitrag gesehen, in dem es um junge Leute (Gymnasium) ging, deren quellenkritisches Verhalten gecheckt wurde. Das Ergebnis war niederschmetternd. Nichts haben die diesbezüglich in den vielen Jahren, in denen wir mit Internet und SM leben, dazugelernt. Im Gegenteil. Die meisten übernahmen die «Informationen», sie nahmen sie für bare Münze. Erschütternd!
Es fehlt sicher an verständlichen Erklärungen komplexer Zusammenhänge. Zum Beispiel an solchen, die Mai Thi Nguyen-Kim zur Verfügung stellt. Wo etwas sollte es auch für politische Fragen geben. Die Kommentarspalten großer Zeitungen reichen dafür nicht aus, sie setzen zu viel voraus. Und Faktenchecker – nun darüber müssen wir auch nicht mehr reden. Die haben sich weitgehend angreifbar und in gewissen Kreisen unglaubwürdig gemacht. Das ist die Crux, wenn man den Autoren gewisse politische Präferenzen nachsagen kann.
Das AfD-Spitzenpersonal wie Baumann oder Brandner und die anderen nörgeln an allem herum. Nicht zuletzt ja auch an den Corona-Maßnahmen der Regierung. Sie bieten aber NULL an, wie mit dem Thema umzugehen ist. Für sie wäre es wohl logisch, die Pandemie einfach so laufen zu lassen. Ob die beiden es, sollten sie sich selbst infizieren, überlegen würden? Ich glaube ja, genügend Angriffsfläche hätte das Virus.
Hoffen wir, dass die Demokraten stark genug sind und dass der Sozialstaat sich nicht so übernimmt, dass dieser Pfeiler, von dem wir beide der Meinung sind, dass er wesentlich für das funktionieren ist, nicht einbricht.
Frau Ardern ist so populär, dass sie jetzt allein regieren kann. Sie ist kommunikativ sehr gut und schafft es, viele Menschen zu integrieren. Das war offenbar der Erfolgsgarant. Dass sie politische eine eher kritische Bilanz vorzuweisen hatte, darf dabei aber nicht vergessen werden. Sie hat nicht einen Bruchteil von dem umgesetzt, was sie vor ihrer ersten Wahl versprochen hatte.
Mich tröstet immer ein bisschen, dass es doch viele Leute gibt, die zum Staat stehen und nicht alles mies machen. Es gibt genug Gründe, sich darüber zu freuen, in diesem Land zu leben. Es gibt leider nur auch die Nörgler, für die alles nur schlecht ist. Heute morgen las ich bei Welt Online einen Artikel über die gestrigen Corona-Beschlüsse der Regierung. Die über 1000 Kommentare sind derart negativ und triefen von Besserwisserei, dass einem das Frühstück zurückkommen könnte.
Danke noch einmal für deinen tollen und langen Kommentar. ᓚᘏᗢ
Mai Thi fand ich auch mal klasse, nachdem ich aber ihr Video zum Thema «Pharma-Verschwörung» (https://www.youtube.com/watch?v=vDgnsMKWbZs) gesehen habe, halte ich nicht mehr allzu viel von ihr, denn das war total daneben. Quintessenz: alle Pharma-Unternehmen forschen was das Zeug, alleine zum Wohle der Menschheit, ohne Hintergedanken, alles paletti. Themen wie Contergan, absichtlich zu teure Medikamente oder die Tatsache, dass über 70% aller Medikamente, die neu zugelassen werden, keinen Nutzen bringen, hat sie dabei gekonnt ignoriert. Das Ganze direkt mit so einem Unterton, als ob alle, die der Pharmaindustrie kritisch gegenüber stehen oder zumindest das Treiben dieses Industriezweigs hinterfragen, Verschwörungstheoretiker wären. Da hätte ich mir schon ein wenig Differenzierung gewünscht, war aber leider Fehlanzeige.
Erklärvideos zu Politik gibt’s übrigens, sogar sehr gute, z.B. den YouTube-Kanal «MrWissen2Go». Dahinter verbirgt sich Mirko Drotschmann, ein Journalist, der Zusammenhänge sehr gut erklären kann und hochinteressante Fragestellungen bespricht. Sein Kanal ist übrigens Teil des FUNK-Netzwerks der ARD. Den Kanal Simplicissimus kann ich auch empfehlen und natürlich «Jung & Naiv» von Tilo Jung, der auch weiß, was er sagt.
Noch kurz zu Frau Ardern. Die hat natürlich vieles, was sie angekündigt hat, nicht geschafft, aber mal Hand auf’s Herz: welcher Staatschef hat das jemals? Okay, die AgD würde wahrscheinlich versprechen, Deutschland in einen faschistischen Staat umzubauen und das wahrscheinlich auch schaffen 🙁
Hallo Martin, das Video muss ich mir mal ansehen. Es ist vielleicht unvermeidlich, dass Fehler passieren. Egal, wie gut solche Angebote insgesamt vielleicht zu bewerten sind. Wenn es so ist, wie du schreibst, wäre das nicht das, was ich bisher von ihr an qualitativen Beiträgen kannte. Jung und Naiv kenne ich einigermaßen gut. Ich habe schon die irre langen Beiträge von Anfang bis Ende angehört. Das Problem ist aber leider, dass der Kanal als ziemlich links gilt und zwar zu Recht, wie ich finde. Das heißt aber nicht, dass ich nicht genau an solche Formate gedacht hätte. Es gibt übrigens viele wirklich gute politische Podcasts, man muss sie leider aber erst einmal finden. Außerdem neigen die Angebote oft dazu, allzu lang zu sein. Aber das ist bei der Komplexität der Herausforderungen vermutlich nicht anders zu machen. Adern finde ich persönlich auch gut. Mir hat gefallen, wie sie nach dem Attentat in Christchurch gewirkt hat. Das fand ich sehr überzeugend.