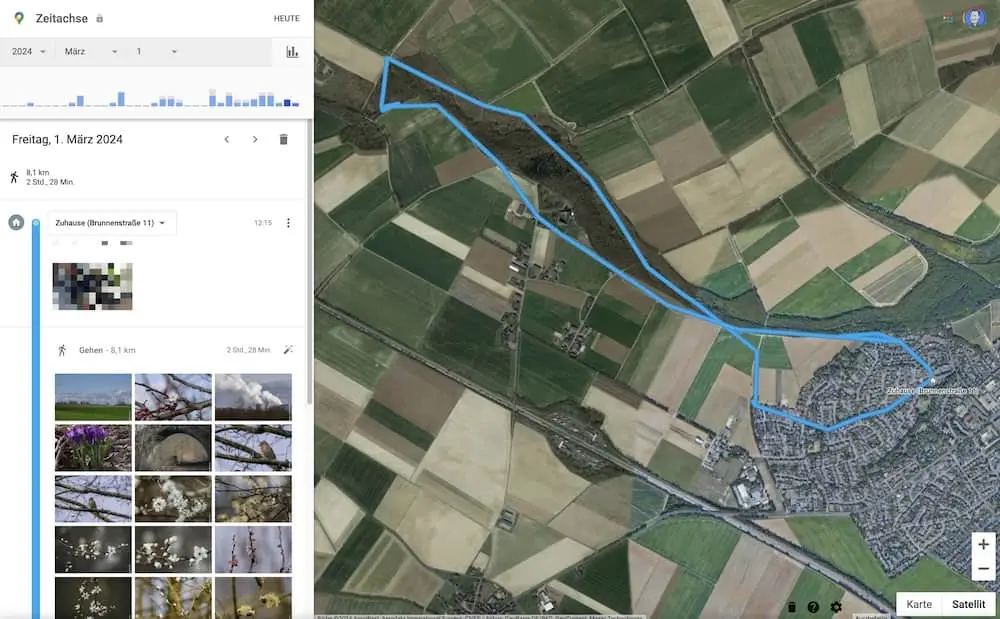Vor langer Zeit streikte die IG Metall für die 35-Stunden-Woche. Es ist 40 Jahre her, dass die IG Metall fast sieben Wochen lang für dieses Ziel streikte. Aussperrungen und Streik im Wechsel beschäftigten das Land. Es ging auch darum, etwas für die damals 2,5 Mio. Erwerbslosen zu tun.
Gestreikt wurde regional, während die Arbeitgeber bundesweit 500.000 Mitarbeiter aussperrten. Es wurde mit harten Bandagen gekämpft.
Bis 1995 hat die schrittweise Reduzierung der Arbeitszeit auf 35 Stunden je Woche gedauert. War eine 35-Stunden-Woche verkraftbar für die Industrie? Wie wirkte sich ihre Einführung auf die Wettbewerbsfähigkeit aus, gibt es seither weniger krankheitsbedingte Ausfälle innerhalb der Branche? Immerhin liegt die Einführung im kommenden Jahr schon 25 Jahre zurück.
Wahrscheinlich kommt es darauf an, wen man fragt. Die Gewerkschafter werden die Erfahrungen schon allein aufgrund der Rechtfertigung des damals einzigartig harten Arbeitskampfes einen positiven Schluss ziehen. Ob die Arbeitgeber lieber die 40-Stunden-Woche zurück haben wollen?
Heute sind die Zeiten ganz andere. Die Autobauer, die Stahlindustrie stehen unter einem unvergleichbaren Wettbewerbsdruck und der Arbeitskräftemangel ist inzwischen ein Standortnachteil. Manchmal scheint es mir, als hätten manche den Schuss nicht gehört. Allerdings gibt es auch die Seite, die von einer wachsenden Zahl von Menschen erzählt, die der Job krank gemacht hat. Früher redeten wir von Stress, heute ist das Burn-out-Syndrom das “Ende vom Lied”. Als Schutzmaßnahme entsteht so etwas wie das rettende Ufer in Gestalt des Sabbaticals und allgemein die Work-Life-Balance.
Die Menschen in den Branchen Metallgewerbe, Fahrzeugbau und Maschinenbau arbeiten 35,1 bzw. 35 Wochenstunden. Viele andere ordnen sich zwischen 36 und 40 Arbeitsstunden je Woche ein. Dies sind Durchschnittswerte.
Die Hälfte der Vollbeschäftigten in Deutschland arbeitet 40 bis 47 Wochenstunden.
Seit einiger Zeit erhebt die Gewerkschaft IG Metall die Forderung nach der 4-Tage-Woche. 35 Stunden sind in der Stahlindustrie üblich. Nun lautet die Parole: 32 Stunden in 4 Tagen.
Unseren Gewerkschaften dürfte aufgefallen sein, dass sich die Grundlagen für derartige Forderungen massiv verschlechtert haben. Für mich sind die Forderungen der Gewerkschaft angesichts der internationalen Wettbewerbssituation und Arbeitskräftemangels nicht nachvollziehbar. 27,2 Mio. Menschen arbeiteten im Jahr 2022 in Vollzeit. 30 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeiteten im Jahre 2022 in Teilzeit. Wäre Letzteres nicht ein Hinweis darauf, welches Potenzial an Arbeitskräften in unserem Land sozusagen brach liegt? Wenn wir also den Arbeitskräftemangel beheben möchten, wäre eine weitere Reduzierung von Arbeitsstunden kontraproduktiv. Oder? Außerdem könnte helfen, mehr Frauen in Vollzeitbeschäftigung zu bringen.
Vor 30 Jahren arbeiteten 70 Prozent der angestellten Frauen Vollzeit, 30 Prozent Teilzeit. Heute sind wir bei 50 Prozent zu 50 Prozent. Die Teilzeitquote bleibt bei Frauen bis zum Ende des Erwebslebens dabei konstant hoch. Männer arbeiten weiterhin mehrheitlich Vollzeit, wenngleich auch hier die Teilzeitquote anzog auf zwölf Prozent.
Quelle
2022 arbeiteten 9 Millionen Frauen in Teilzeit, Männer sind mit 2 Millionen Teilzeitstellen stark unterrepräsentiert. Wenn 66 % aller erwerbstätigen Mütter in Teilzeit arbeiten, lässt dies Schlüsse auf bekannte Defizite in der Betreuung (in Kitas, Schulen) zu. Die Frage ist nur, woher die Betreuungsangebote kommen sollen, wenn die Lage durch weitere (allgemeine) Arbeitszeitverkürzungen noch verschärft wird?
Die GDL und andere Gewerkschaften geben einen Trend vor, der für Deutschland aus meiner Sicht einen Irrweg darstellt. Nicht weniger, mehr Arbeit wäre das Gebot der Stunde.
Die Idee, dass eine Entlastung der Arbeitnehmer von anstrengenden Jobs die allgemeine Attraktivität steigern könnte, bleibt oft nicht mehr als eine schöne Theorie. Bessere Arbeitsbedingungen werden oft als Lösung angepriesen. Jedoch ist es eine Realität, dass die fehlenden Arbeitsstunden nicht einfach durch zusätzliche Mitarbeiter kompensiert werden können. Es besteht eine zeitliche Diskrepanz, die theoretisch schwer zu überwinden ist. Positive Auswirkungen könnten meiner Meinung nach nur langfristig spürbar werden. Leider haben wir nicht die Zeit dafür.
Wir müssen mehr arbeiten, obwohl der Zeitgeist gerade das Gegenteil fordert. Zudem spielt die Lage am Arbeitsmarkt all denen in die Hände, die glauben, nun am längeren Hebel zu sitzen. Ja, dieser Arbeitsmarkt hat sich grundlegend verändert, die Arbeitnehmer sind am Zug. Jetzt wird sich zeigen, ob sie in Gänze verantwortungsbewusst handeln oder ob sie mit unangemessenen Forderungen den Wirtschaftsstandort Deutschland irreversibel schädigen.
Hoffentlich wird er (Claus Weselsky u.s.w.), zumindest außerhalb gewisser Nischen stattfindet, überwunden. Sonst wird die Wirtschaft im Land nicht aufgrund irgendeiner angeblich misslungenen Energiewende stranden, sondern weil die Bevölkerung sich hat einreden lassen, dass weniger arbeiten mehr bedeutet.